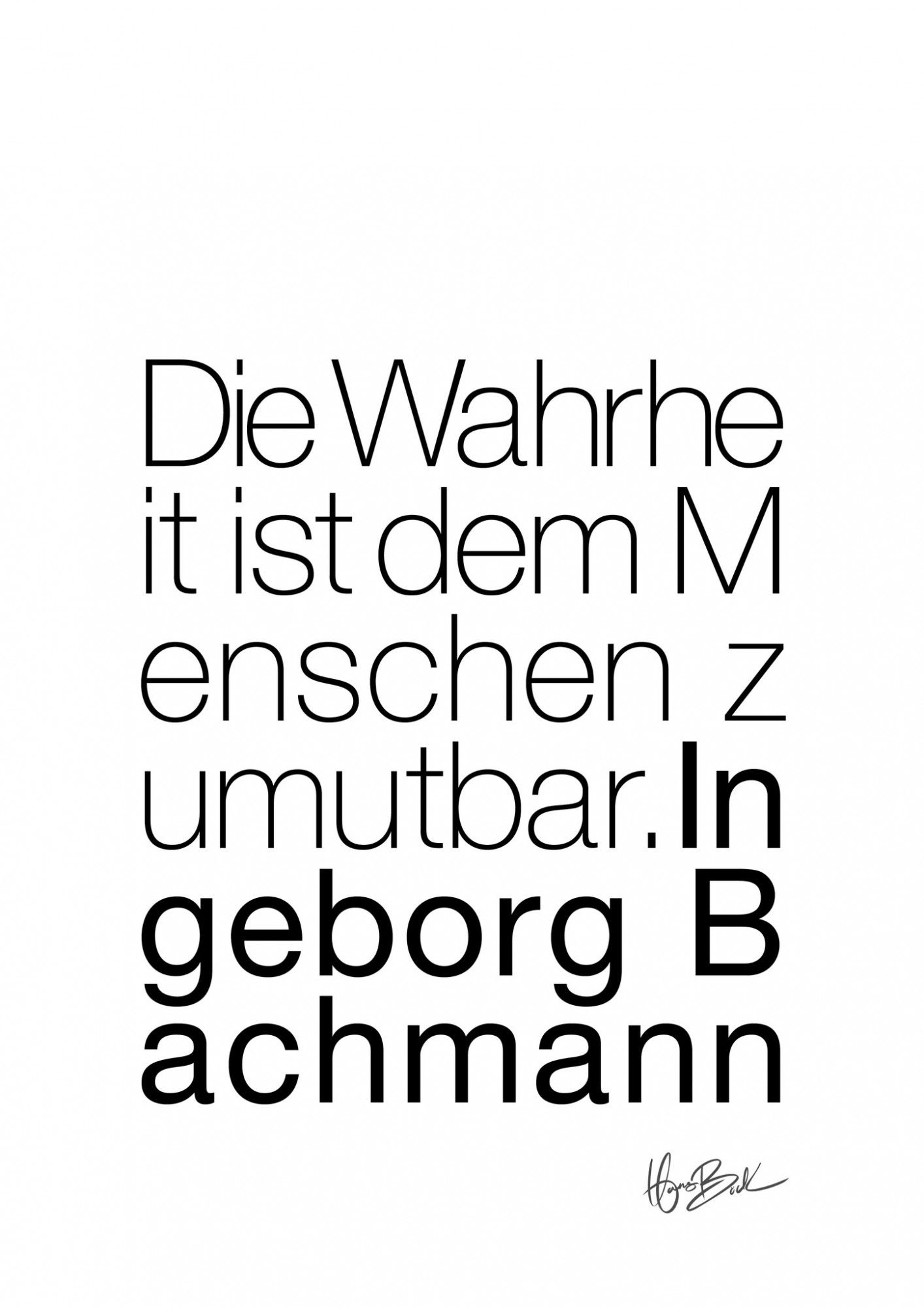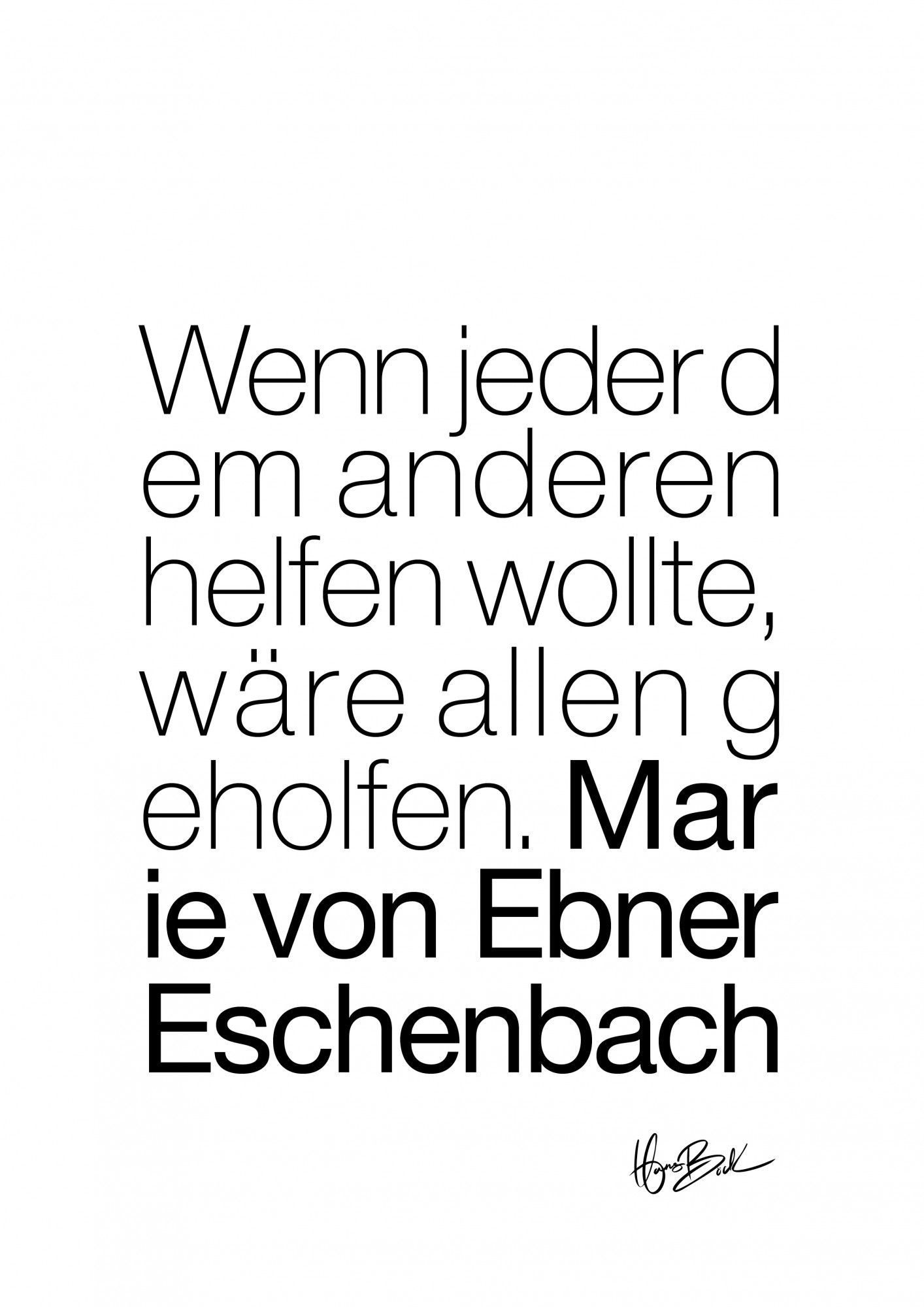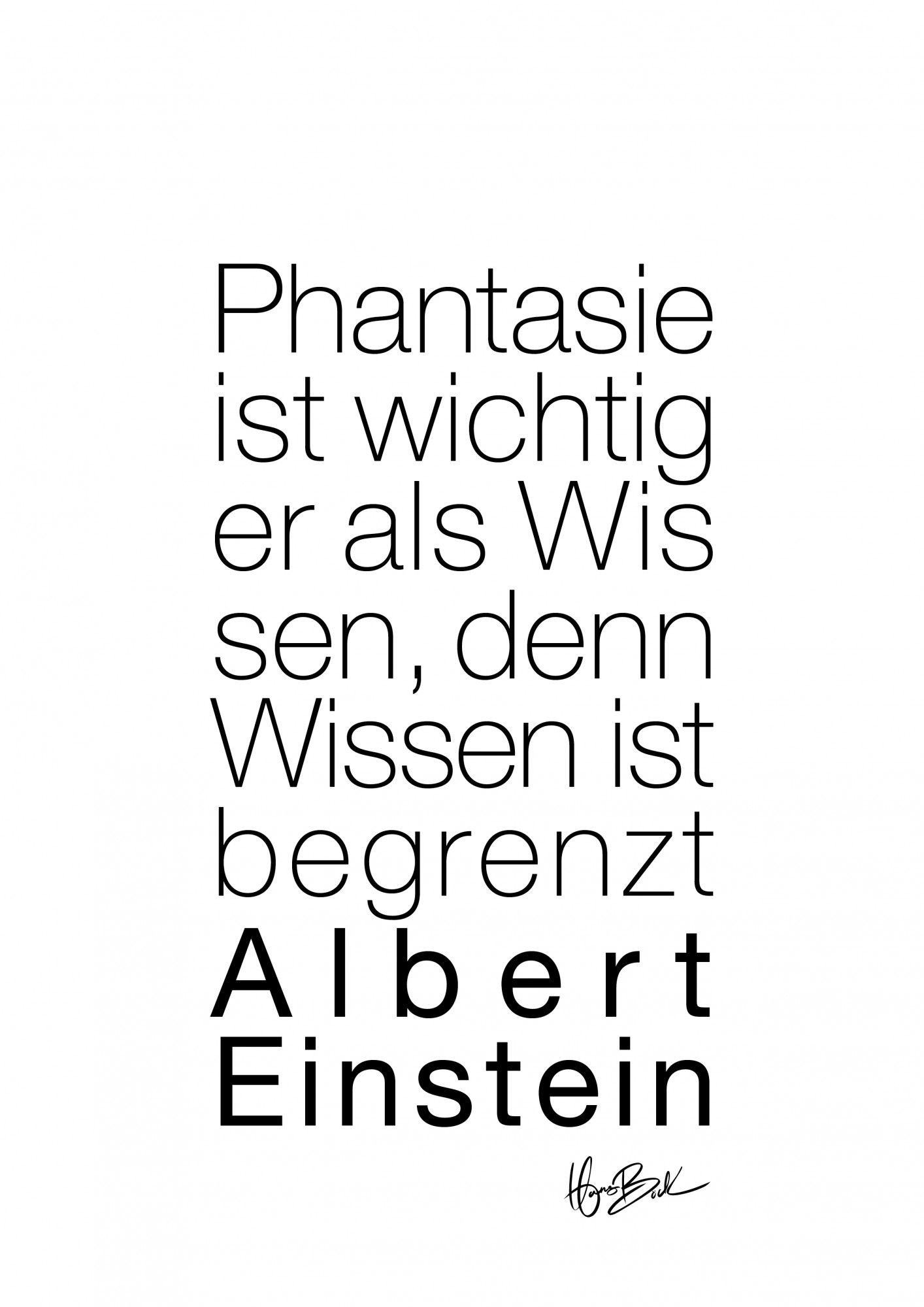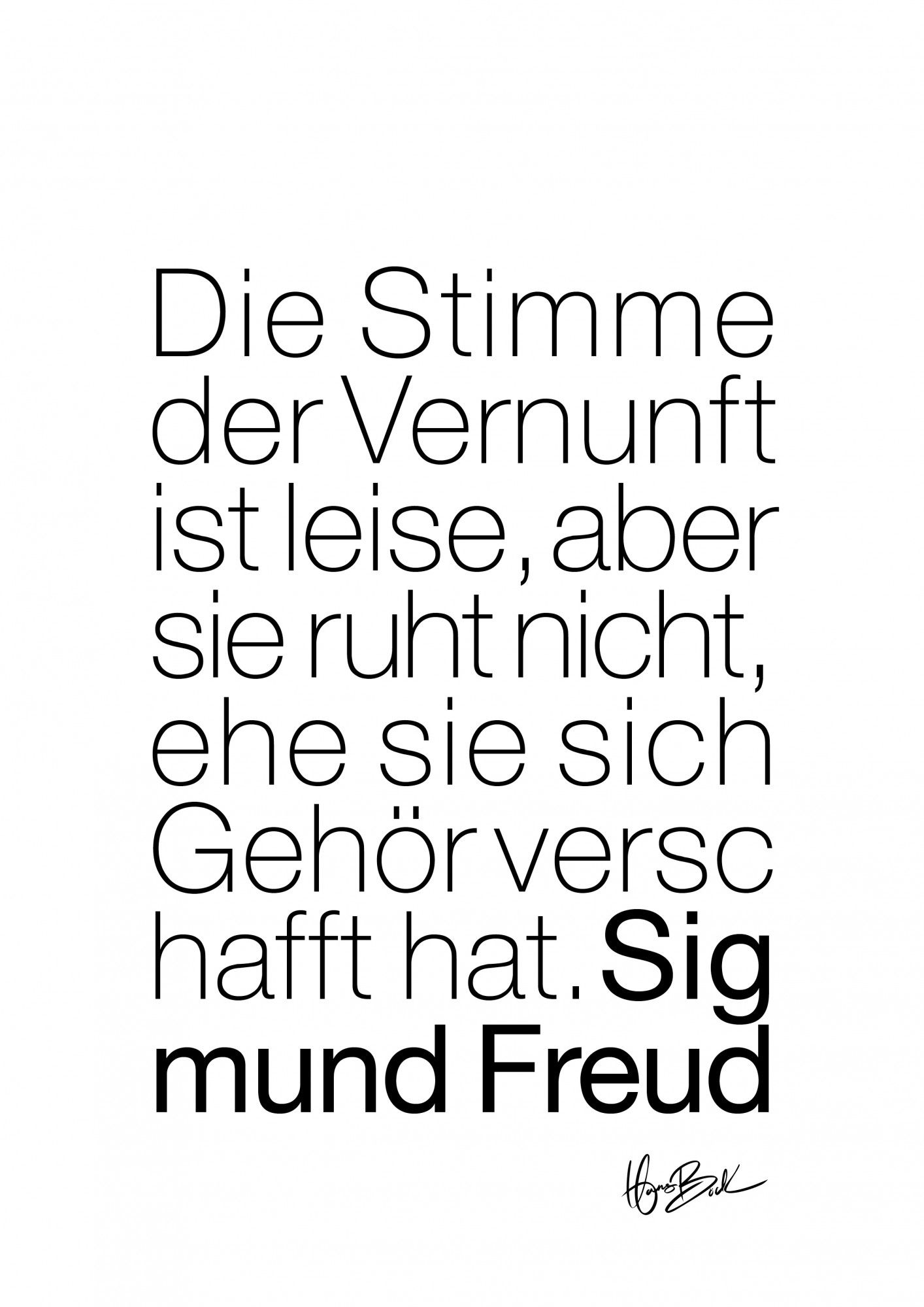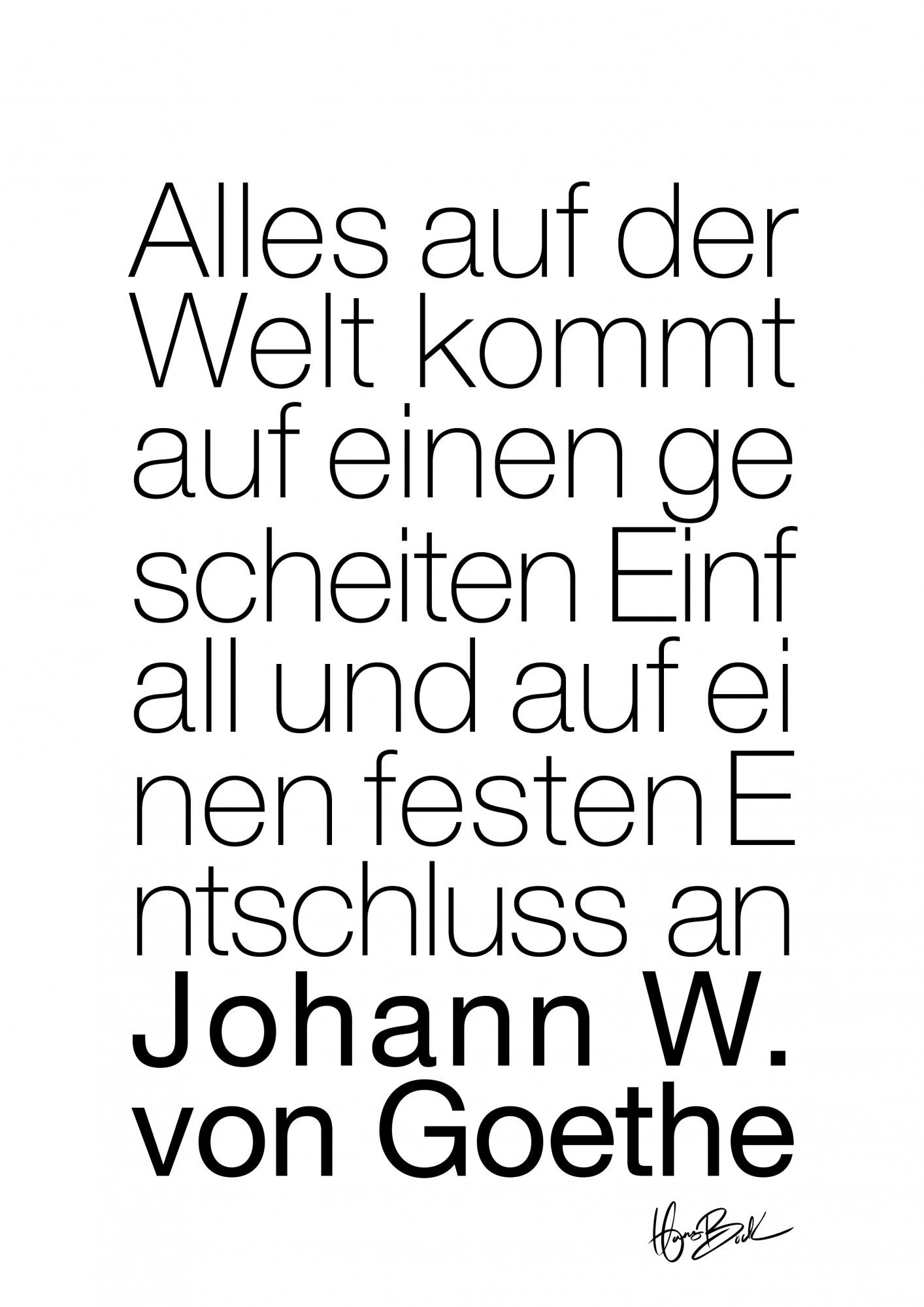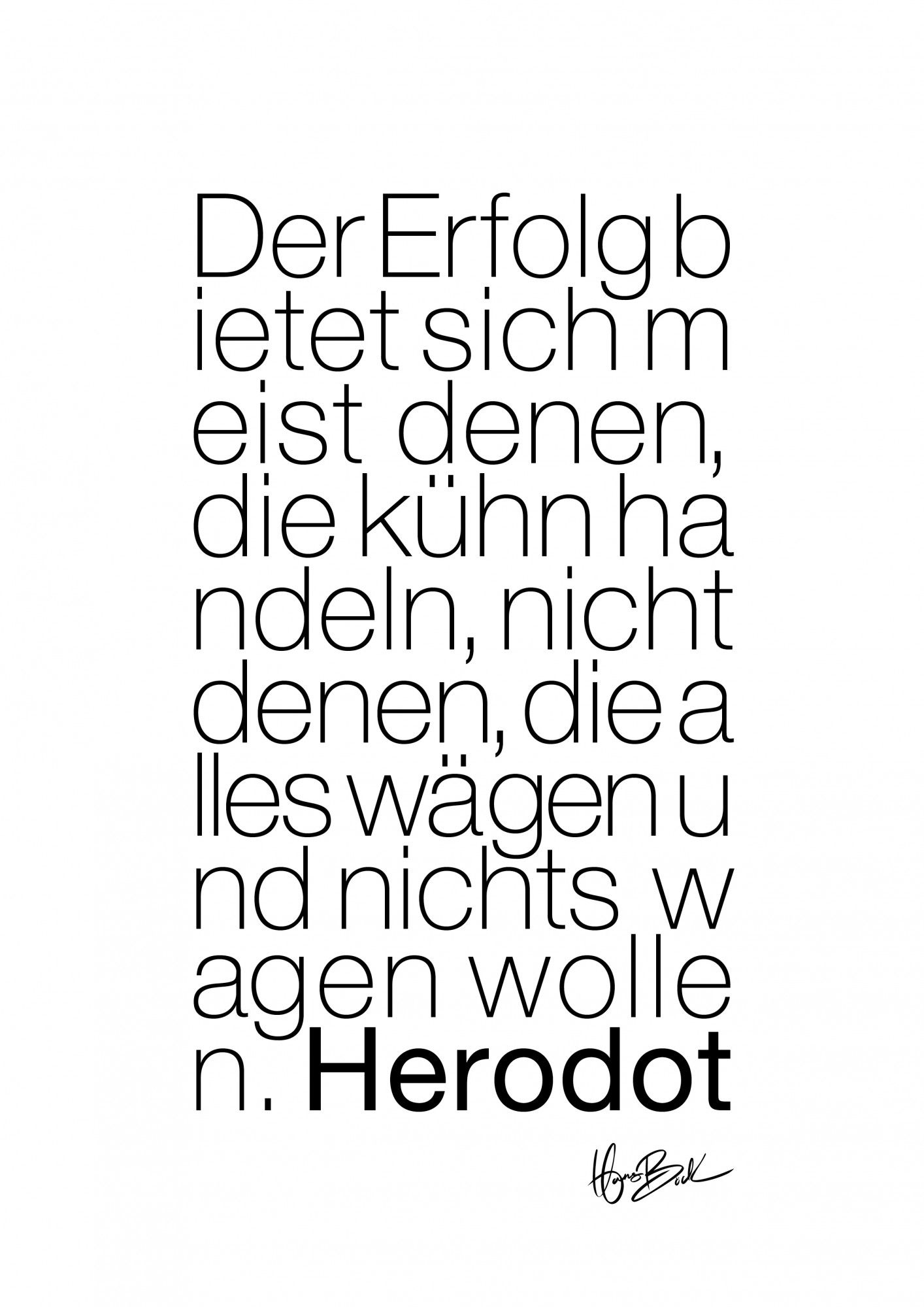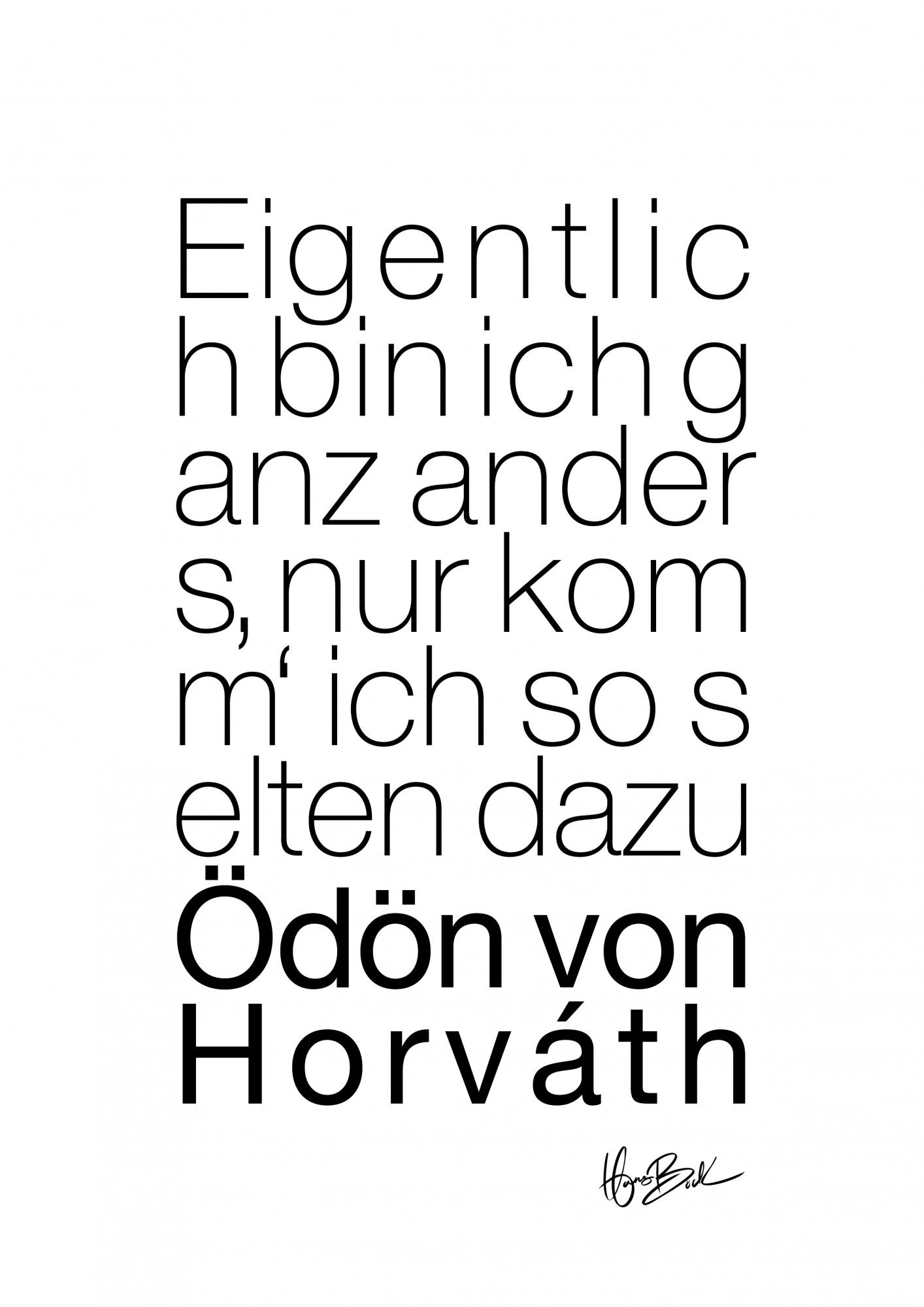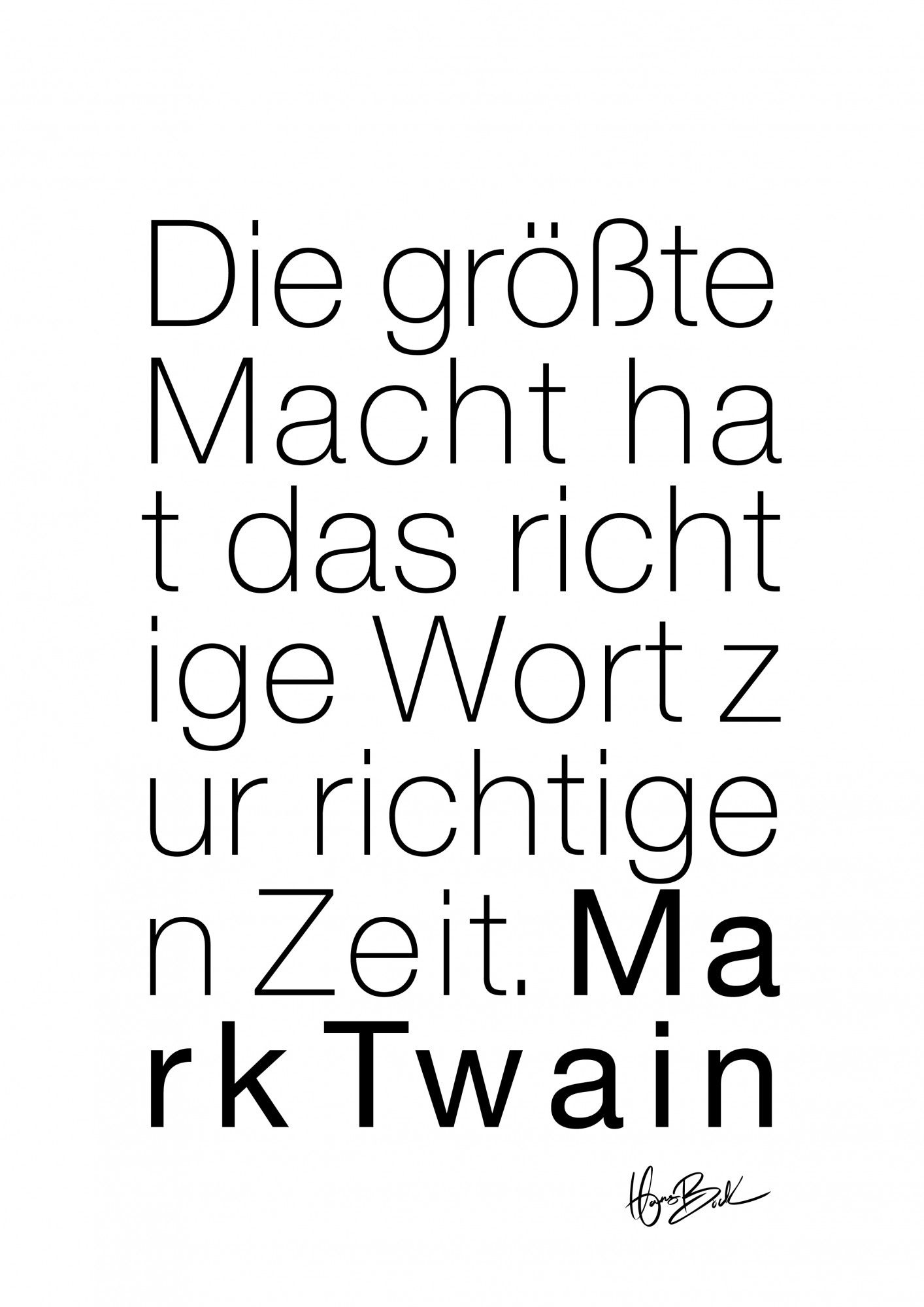Zitate zu "EU - Europa"
-
Joachim Gauck
"Die Freiheit in der Freiheit gestalten". Vor 23 Jahren stand ich auf den Stufen des Reichstagsgebäudes in Berlin und ich erinnere mich noch heute an den Klang der Freiheitsglocke, als um Mitternacht die Fahne der Einheit aufgezogen wurde. Es war der Abschluss einer bewegenden Zeit, vom Aufbruch im Herbst 1989 bis zum Tag der Vereinigung - für mich war es die beglückendste Zeit meines Lebens. // Der Freiheitswille der Unterdrückten hatte die Unterdrücker tatsächlich entmachtet - in Danzig, in Prag, in Budapest und in Leipzig. Was niedergehalten war, stand auf. Und was auseinandergerissen war, das wuchs zusammen. Aus Deutschland wurde wieder eins. Europa überwand die Spaltung in Ost und West. // Ich denke auch zurück an die Monate der Einigung, und nicht wenige der Abgeordneten der ersten frei gewählten Volkskammer sind heute unter uns. Wie viel Bereitschaft zur Verantwortung war damals notwendig, um Deutschland zu vereinen, wie viel Entscheidungsmut, wie viel Improvisationsgabe. Wie vieles war zu regeln: diplomatische und Bündnisfragen, grundsätzliche Weichenstellungen, hochwichtige, aber manchmal auch banale Details. Alle, die damals mitwirkten, waren Lernende, manchmal auch Irrende - aber immer waren sie, waren wir Gestaltende! Der 3. Oktober erinnert uns also nicht nur an die überwundene Ohnmacht. Er zeugt auch von dem Willen, die Freiheit in der Freiheit zu gestalten. // All das klingt nach am heutigen Tag, dem Tag der Deutschen Einheit. // Wir blicken zurück auf das, was wir konnten - dankbar für das Vertrauen, das andere in uns setzten, und stolz auf das, was wir seitdem erreicht haben: Ostdeutsche, Westdeutsche und Neudeutsche, alle zusammen - wir alle hier im Lande, zusammen mit Freunden und Partnern in Europa und der ganzen Welt. Das vereinigte Deutschland, es ist heute wirtschaftlich stark, es ist weltweit geachtet und gefordert. Unsere Demokratie ist lebendig und stabil. Deutschland hat ein Gesellschaftsmodell entwickelt, das ein hohes Maß an Einverständnis der Bürger mit ihrem Land hervorgebracht hat. Für viele Länder in der Welt sind wir sogar Vorbild geworden - für Menschen meiner Generation fast unvorstellbar. All das ist Grund zur Dankbarkeit und Freude - einer Freude, die uns heute aber vor allem Ansporn sein soll! // Unser Land steht nun wieder vor einem neuen Anfang - so wie alle vier Jahre. Wir hatten eine Wahl. 44 289 652 Deutsche haben darüber abgestimmt, welche Bürgerinnen und Bürger künftig mitbestimmen werden über die Dinge des öffentlichen Lebens. Meine Damen und Herren Abgeordnete hier: Ich wünsche Ihnen Leidenschaft, Ehrgeiz und Achtsamkeit für all das, was Sie gestalten müssen - und was auf uns zukommt. // Denn vieles fordert uns heute heraus. Besonders auf drei große Herausforderungen möchte ich heute eingehen. Entwicklungen, die nicht jederzeit und nicht für jeden im Alltag spürbar sind, weil sie langfristig wirken. Entwicklungen auch, die nicht mehr allein innerhalb der Landesgrenzen zu regeln sind. // Erstens: In einer Welt voller Krisen und Umbrüche wächst Deutschland neue Verantwortung zu. Wie nehmen wir sie an? Zweitens: Die digitale Revolution wälzt unsere Gesellschaft so grundlegend um wie einst die Erfindung des Buchdrucks oder der Dampfmaschine. Wie gehen wir mit den Folgen um? Beginnen möchte ich allerdings - drittens - mit dem demographischen Wandel. Unsere Bevölkerung wird in beispielloser Weise altern und dabei schrumpfen. Wie bewahren wir Lebenschancen und Zusammenhalt? // Tatsächlich wird es immer weniger Jungen zufallen, für immer mehr Ältere zu sorgen. Das schafft eine schwierige Lage, die unsere Kinder und Enkel möglicherweise erheblich einschränken wird. Andererseits entsteht dadurch ein Druck, der manches in Bewegung bringt, ja einfordert, was ohnehin überfällig und richtig ist. Arbeitgeber etwa sind längst dabei, um Zuwanderer zu werben. Oder ältere Menschen erhalten neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt und zudem nutzen immer mehr Ältere die Zeitspanne nach der Berufstätigkeit für bürgerschaftliches Engagement. Immer mehr Frauen streben ins Arbeitsleben und in Führungspositionen. Dort dürfen es noch mehr werden. Die starren Rollenbilder brechen weiter auf. Neue Vereinbarungen zwischen Mann und Frau, zwischen Familie und Beruf werden möglich. // Wenn die Gesellschaft der Wenigeren nicht eine Gesellschaft des Weniger werden soll, dann dürfen keine Fähigkeiten brach liegen. Wir wissen doch, dass es so viele sind, die mehr können könnten, wenn ihnen mehr geholfen und auch mehr abverlangt würde. Ich meine die formal Geringqualifizierten, die zu fördern und einzubinden sind. Ich meine Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern, in denen Bildungsehrgeiz oder Bücher einfach fehlen. // Jeder Einzelne ist doch mit ganz eigenen Möglichkeiten geboren - und es ist ganz egal wo, in Thüringen oder Kalabrien, in Bayern oder in Anatolien. Diese Fähigkeiten gilt es zu entdecken, zu entwickeln und Menschen sogar aus niederdrückender Chancenlosigkeit herauszuholen. Bildung auch als Förderung von Urteilskraft, sozialer Verantwortung und Persönlichkeit, Bildung als Grundlage eines selbstbestimmten, erfüllten Lebens - das ist für mich ein Bürgerrecht und ein Gebot der Demokratie. // Unser Ziel muss lauten: Niemand wird zurückgelassen, nicht am Anfang und nicht am Ende eines langen Lebens. Angenommen und gestaltet, vermag der demographische Wandel unsere Gesellschaft fairer und solidarischer, aber auch vielfältiger und beweglicher und damit zukunftsfähig zu machen. // Die Bedingungen dafür zu schaffen, ist vor allem Aufgabe der Politik. Die Politik hat sich zwar auf den Weg gemacht, das sehen wir alle - aber oftmals haben wir den Eindruck, sie bewegt sich nicht immer schnell genug. Wie lange ringen wir nun schon um die frühkindliche Betreuung? Oder um die Verbesserung unserer Pflegesysteme? Oder um Modernisierung in der Einwanderungspolitik und des Staatsbürgerschaftsrechts? // Mir ist bewusst - ich müsste noch über viele innenpolitische Herausforderungen sprechen: über die Energiewende, die erst noch eine Erfolgsgeschichte werden muss. Auch über Staatsverschuldung etwa oder die niedrige Investitionsquote, die nicht ausreicht, um das zu erhalten, was vorige Generationen aufgebaut haben. Und darüber, dass noch nicht ehrlich genug diskutiert wird über die Kluft zwischen Wünschenswertem und dem Machbaren. // Viele können in den kommenden Jahren vieles noch besser machen, damit die Jahrzehnte danach gut werden. So wie wir heute davon profitieren, dass wir vor einem Jahrzehnt zu Reformen uns durchgerungen haben, so kann es uns übermorgen nutzen, wenn wir morgen - meine Damen und Herren Abgeordnete! - wiederum Mut zu weitsichtigen Reformen aufbringen. Denn wir wollen doch zeigen und wir wollen es erleben, dass eine freiheitliche Gesellschaft in jedem Wandel trotz aller Schwierigkeiten neue Entfaltungsmöglichkeiten für den Einzelnen und für die Vielen erschließen kann. // Entfaltungsmöglichkeiten! Wie viele haben wir in den vergangenen Jahren hinzugewonnen, durch Internet und durch mobile Kommunikation - ein Umbruch, dessen Konsequenzen die meisten bislang weder richtig erfasst noch gar gestaltet haben. Wir befinden uns mitten in einem Epochenwechsel. Ähnlich wie einst die industrielle Revolution verändert heute die digitale Revolution unsere gesamte Lebens- und Arbeitswelt, das Verhältnis vom Bürger zum Staat, das Bild vom Ich und vom Anderen. Ja, wir können sagen: Unser Bild vom Menschen wird sich ändern. // Nie zuvor hatten so viele Menschen Zugang zu so viel Information, nie zuvor konnte man weltweit so leicht Gleichgesinnte finden, war es technisch einfacher, Widerstand gegen autoritäre Regime zu organisieren. Manchmal denke ich: Hätten wir doch 1989 damals in Mittel- und Osteuropa uns so miteinander vernetzen können! // Die digitalen Technologien sind Plattformen für gemeinschaftliches Handeln, Treiber von Innovation und Wohlstand, von Demokratie und Freiheit, und nicht zuletzt sind sie großartige Erleichterungsmaschinen für den Alltag. Sie navigieren uns zum Ziel, sie dienen uns als Lexikon, als Spielwiese, als Chatraum, und sie ersetzen den Gang zur Bank ebenso wie den ins Büro. // Wohin dieser tiefgreifende technische Wandel führen wird, darüber haben wir einfachen "User" bislang wenig nachgedacht. Erst die Berichte über die Datensammlung der Dienste befreundeter Länder haben uns mit einer Realität konfrontiert, die wir bis dahin für unvorstellbar hielten. Erst da wurde den meisten die Gefahr für die Privatsphäre bewusst. // Vor 30 Jahren, erinnern wir uns, wehrten sich Bundesbürger noch leidenschaftlich gegen die Volkszählung und setzten am Ende das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch. Dafür hat unser Bundesverfassungsgericht gesorgt. Und heute? Heute tragen Menschen freiwillig oder gedankenlos bei jedem Klick ins Netz Persönliches zu Markte. Viele der Jüngeren vertrauen sozialen Netzwerken sogar ihr ganzes Leben an. // Ausgeliefertsein und Selbstauslieferung sind kaum voneinander zu trennen. Es schwindet jene Privatsphäre, die unsere Vorfahren doch einst gegen den Staat erkämpften und die wir in totalitären Systemen gegen Gleichschaltung und Gesinnungsschnüffelei so hartnäckig zu verteidigen suchten. Öffentlichkeit erscheint heute vielen nicht mehr als Bedrohung, sondern als Verheißung, die Wahrnehmung und Anerkennung verspricht. // Sie verstehen nicht oder sie wollen nicht wissen, dass sie so mit bauen an einem digitalen Zwilling ihrer realen Person, der neben ihren Stärken eben auch ihre Schwächen enthüllt - oder enthüllen könnte. Der ihre Misserfolge und Verführbarkeiten aufdecken oder gar sensible Informationen über Krankheiten preisgeben könnte. Der den Einzelnen transparent, kalkulierbar und manipulierbar werden lässt für Dienste und Politik, Kommerz und Arbeitsmarkt. // Wie doppelgesichtig die digitale Revolution ist, zeigt sich besonders am Arbeitsplatz. Vielen Beschäftigten kommt die neue Technik entgegen, weil sie erlaubt, von Hause oder gar im Café zu arbeiten und die Arbeitszeit völlig frei zu wählen. Gleichzeitig wird aber die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit verwischt, was ständige Verfügbarkeit bedeuten kann - rund um die Uhr. // Historisch betrachtet, sind Entwicklungssprünge nichts Neues. Im ersten Moment erleben wir sie allerdings ratlos, vielleicht auch ohnmächtig. Naturgemäß hinken dann Gesetze, Konventionen und gesellschaftliche Verabredungen der technischen Entwicklung hinterher. Wie noch bei jeder Innovation gilt es auch jetzt, die Ängste nicht übermächtig werden zu lassen, sondern als aufgeklärte und ermächtigte Bürger zu handeln. So sollte der Datenschutz für den Erhalt der Privatsphäre so wichtig werden wie der Umweltschutz für den Erhalt der Lebensgrundlagen. Wir wollen und sollten die Vorteile der digitalen Welt nutzen, uns gegen ihre Nachteile aber bestmöglich schützen. // Es gilt also, Lösungen zu suchen, politische und gesellschaftliche, rechtliche, ethische und ganz praktische: Was darf, was muss ein freiheitlicher Staat im Geheimen tun, um seine Bürger durch Nachrichtendienste vor Gewalt und Terror zu schützen? Was aber darf er nicht tun, weil sonst die Freiheit der Sicherheit geopfert wird? Wie muss der Arbeitsmarkt aussehen, damit der allzeit verfügbare Mensch nicht zu so etwas wie einem digitalen Untertanen wird? Wie existieren Familie und Freundschaften neben den virtuellen Beziehungen? Wie können Kinder und Jugendliche das Netz nutzen, ohne darin gefangen zu werden? // Wir brauchen also Gesetze, Konventionen und gesellschaftliche Verabredungen, die diesem epochalen Wandel Rechnung tragen. // Gerade in Demokratien muss Politik schon reagieren, wenn ein Problem erst am Horizont auftaucht. Und sie muss ständig nachjustieren, sobald die Konturen klarer hervortreten. Das ist übrigens eine ihrer Stärken. // Diese Stärke ist es auch, die wir für eine weitere Herausforderung unserer Zeit brauchen: die europäische Integration. Ohne Zweifel ist das Europa in der Krise nicht mehr das Europa vor der Krise. Risse sind sichtbar geworden. // Die Krise hat Ansichten und Institutionen verändert, sie hat Kräfte und Mehrheiten verschoben. Die Zustimmung zu mehr Vergemeinschaftung nimmt ab. Nicht die europäischen Institutionen, sondern nationale Regierungen bestimmen wesentlich die Agenda. Zudem tauchen in Ländern, denen die Rezession vieles abverlangt, alte Zerrbilder eines dominanten Deutschlands auf. // Dies alles will diskutiert und abgewogen sein. Die gute Nachricht lautet: Ein starkes Band aus Mentalität, Kultur und Geschichte, es hält Europa zusammen. Entscheidend ist aber unser unbedingter Wille zur gemeinsamen Gestaltung der Zukunft. Europa, so spüren wir jetzt, kennt nicht nur eine Gestalt, auch nicht nur eine politische Organisationsform seiner Gemeinschaft. Da haben wir zu streiten und zu diskutieren über die beste Form der Zusammenarbeit, nicht aber über den Zusammenhalt Europas! Und unsere Einigungen haben wir so zu kommunizieren, dass die europäischen Völker die Lösungen akzeptieren und mittragen können. Es bleibt die Aufgabe der Politik - und als Bundespräsident nehme ich mich da überhaupt nicht aus - das Europa Verbindende zu stärken. // Was ist nun die Aufgabe Deutschlands in Europa und in der Welt? Manche Nachbarländer fürchten ja eine starke Rolle Deutschlands, aber andere wünschen sie sich. Auch wir selbst schwanken: Weniger Verantwortung, das geht eigentlich nicht länger, aber an mehr Verantwortung müssen wir uns erst noch gewöhnen. // Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb die politische Denkerin Hannah Arendt: "Es sieht so aus, als ob sich die Deutschen nun, nachdem man ihnen die Weltherrschaft verwehrt hat, in die Ohnmacht verliebt hätten." Deutschland hatte, wir wissen es alle, Europa in Trümmer gelegt und Millionen Menschenleben vernichtet. Was Arendt als Ohnmacht beschrieb, hatte damals eine politische Ratio. Das besiegte Deutschland musste sich erst ein neues Vertrauen erwerben und seine Souveränität wiedererlangen. // Vor wenigen Wochen, bei meinem Besuch in Frankreich, da wurde ich allerdings mit der Frage konfrontiert: Erinnern wir Deutsche auch deshalb so intensiv an unsere Vergangenheit, weil wir eine Entschuldigung dafür suchen, den heutigen Problemen und Konflikten in der Welt auszuweichen? Lassen wir andere unsere Versicherungspolice zahlen? // Es gibt natürlich Gründe, diese Auffassung zu widerlegen oder ihr zu widersprechen. Die Bundeswehr hilft, in Afghanistan und im Kosovo den Frieden zu sichern. Deutschland stützt den Internationalen Strafgerichtshof, es fördert ein Weltklimaabkommen und engagiert sich stark in der Entwicklungszusammenarbeit. Deutschlands Beiträge und Bürgschaften helfen, die Eurozone zu stabilisieren. // Trotzdem, es mehren sich die Stimmen innerhalb und außerhalb unseres Landes, die von Deutschland mehr Engagement in der internationalen Politik fordern. In dieser Liste findet sich ein polnischer Außenminister ebenso wie Professoren aus Oxford oder Princeton. Ihnen gilt Deutschland als schlafwandelnder Riese oder als Zuschauer des Weltgeschehens. Einer meiner Vorgänger, Richard von Weizsäcker, ermuntert Deutschland, sich stärker einzubringen für eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik. // Es stellt sich tatsächlich die Frage: Entspricht unser Engagement der Bedeutung unseres Landes? Deutschland ist bevölkerungsreich, in der Mitte des Kontinents gelegen und die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Zur Stärke unseres Landes gehört, dass wir alle Nachbarn als Freunde gewannen und in internationalen Allianzen zu einem verlässlichen Partner geworden sind. So eingebunden und akzeptiert, konnte Deutschland Freiheit, Frieden und Wohlstand sichern. Diese politische Ordnung und unser Sicherheitssystem gerade in unübersichtlichen Zeiten zu erhalten und zukunftsfähig zu machen - das ist unser wichtigstes Interesse. // Deshalb ist es richtig, wenn andere ebenso wie wir selbst fragen: Nimmt Deutschland seine Verantwortung ausreichend wahr etwa gegenüber den Nachbarn im Osten, im Nahen Osten oder am südlichen Mittelmeer? Welchen Beitrag leistet Deutschland, um die aufstrebenden Schwellenländer als Partner der internationalen Ordnung zu gewinnen? // Und wenn wir einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anstreben: Welche Rolle sind wir dann bereit, bei Krisen in ferneren Weltregionen zu spielen? // Unser Land ist keine Insel. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, wir könnten verschont bleiben von den politischen und ökonomischen, den ökologischen und militärischen Konflikten, wenn wir uns an deren Lösung nicht beteiligen. // Ich mag mir nicht vorstellen, dass Deutschland sich groß macht, um andere zu bevormunden. Aber ich mag mir genauso wenig vorstellen, dass Deutschland sich klein macht, um Risiken und Solidarität zu umgehen. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Land, das sich so als Teil eines Ganzen versteht, muss weder bei uns Deutschen auf Abwehr noch bei unseren Nachbarn auf Misstrauen stoßen. // Nun habe ich Ihnen an diesem Tag der Deutschen Einheit einiges vorgetragen zur Rolle Deutschlands in der Welt, zur digitalen Revolution und zum demographischen Wandel. Was aber ist die Grundmelodie? Ich sehe unser Land als Nation, die nach Jahrzehnten demokratischer Entwicklung "Ja" sagt zu sich selbst. Als Nation, die das ihr Mögliche und ihr Zugewachsene tut, solidarisch im Inneren wie nach außen. Als Nation, die in die Zukunft schaut und dort nicht Bedrohung sieht, sondern Chancen und Gewinn. // Wir hatten eine Wahl - und wir haben sie weiterhin! Der 3. Oktober zeigt: Wir sind nicht ohnmächtig. Und handlungsfähig, das sind wir nicht erst dann, wenn wir das Ende einer Entwicklung kennen. Wir sind es bereits, wenn wir Verantwortung annehmen, mit dem, was wir jetzt wissen, jetzt können, gestaltend eingreifen. // Wir, zusammen einzigartig, schauen uns an diesem Festtag um. Wir sehen, was uns in schwierigen Zeiten gelungen ist. Und wir sind dankbar für all das, was gewachsen ist. Und eine Verheißung kann uns zur Gewissheit werden: Wir müssen glauben, was wir konnten. Dann werden wir können, woran wir glauben.
-
Joachim Gauck
"Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt / schwankt sein Charakterbild in der Geschichte." Wenn je auf einen politisch wirkenden Deutschen dieses Schiller'sche Wort aus dem Prolog zu "Wallenstein" zutrifft, dann auf ihn: Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, kurz: Fürst von Bismarck - preußischer Ministerpräsident, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, Reichskanzler des deutschen Kaiserreiches; kurz: eiserner Kanzler. // Bismarck: Preußen, Junkertum, Kaiserreich, Friedrichsruh, Spiegelsaal, Emser Depesche, Kanzelparagraph, Sozialistengesetz - sind das nicht alles Stichworte einer längst versunkenen Epoche? Stoff höchstens für Denkmäler und Museen? Sind das nicht Geschichten aus grauer Vorzeit? // Dazu eine kleine Zeitrechnung: Otto von Bismarck war noch für 22 Jahre Zeitgenosse Konrad Adenauers. Und wir - zumindest viele von uns - waren noch Zeitgenossen Konrad Adenauers, eines anderen großen Kanzlers der Deutschen. Für mich jedenfalls trifft das zu. So gesehen ist Bismarck also doch noch gar nicht so lange her. // Bismarck hat sich, wie andere geschichtliche Persönlichkeiten, die aus den Zeitläuften besonders herausragen, den zentralen Fragen und Herausforderungen seiner Epoche gewidmet. // "Deutschland? aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens; Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus." // In diesen beiden Versen, die Goethe und Schiller gemeinsam verfasst haben, ohne dass man sagen könnte, wer von den beiden welchen Anteil daran hatte, in diesen sogenannten Xenien drückt sich die ganze deutsche Frage aus, die spätestens seit der französischen Revolution und dann stärker noch seit den Befreiungskriegen die meisten Länder deutscher Zunge beschäftigt: Deutschland - aber wo liegt es, aber was ist es, aber wie kommt es zusammen? // Deutschland: Das ist da zwar längst ein Begriff, aber zu diesem Begriff gibt es keine politische Entsprechung. Die Nation: Eine tiefe, seltsam dringliche Sehnsucht nach Einheit erfasst die deutschen Menschen um 1800, obwohl doch, wie ja die Schiller-Goethe'schen Verse es sagen, Kultur und Geist, Bildung und Humanität blühen und gedeihen - und obwohl die Kultur doch eine Einheit bereits darstellt. Später wird man von Deutschland als einer Kulturnation sprechen, zu der die Königreiche, die Fürsten- und Herzogtümer, Grafschaften und geistlichen Territorien verbunden durch die deutsche Sprache längst geworden waren, obwohl oder gerade weil es eine politische Einheit nicht gab. // Eine Nation sein - diese Idee greift, wir wissen es, auch anderswo um sich im Europa des 19. Jahrhunderts. Geboren ist sie im revolutionären Frankreich, davon ist sie so sehr geprägt, dass man geradezu sagen kann, "Nation" sei der "Eigenname Frankreichs". Nation - das hört sich für die Völker Europas auch sofort nach "Freiheit" an. Denn das gehört nach 1792 doch zusammen: Die eine und unteilbare Nation und die Menschen- und Freiheitsrechte, die in ihr gelten sollen. Dass und wie diese Ideen dann mit Gewalt exportiert werden sollten, worunter gerade Deutschland zu leiden hatte, steht auf einem anderen Blatt. // Nach den Befreiungskriegen, nach der Phase der Restauration und nach der letztlich gescheiterten Revolution von 1848 war in Deutschland die Enttäuschung groß. Nationale Einheit und demokratische Freiheit schienen in weite Ferne gerückt. Dazu kamen die umstürzenden neuen technischen und industriellen Entwicklungen, die eine historisch unerhörte Akzeleration bedeuteten. Städte wuchsen plötzlich, eine Massengesellschaft entstand, der Fortschritt brachte fast jährlich neue Segnungen, und gleichzeitig musste man mit seinen unerwünschten Folgen umgehen. // Die Welt, in der Otto von Bismarck politisch zu wirken begann, war also in jeder Hinsicht in Bewegung. "Das ruhelose Reich" hat Michael Stürmer seine Geschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überschrieben. Dort heißt es: "Nationale Leitbilder wurden [ ] Ersatzformen des Glaubens, gestiftet durch Verlust der Tradition, provoziert durch das Ende aller Sicherheit und erwachsen aus einem Wandel, über dessen Ziele es so wenig Gewissheit gab wie über die Frage, ob er überhaupt ein Ziel habe. Seit 1848 wurde die Nationalisierung der Massen' Grundzug der Epoche " // Wenn wir heute Bismarcks gedenken, der zu den wirkmächtigsten, natürlich auch umstrittensten Gestalten und Gestaltern der deutschen Geschichte gehört, dann müssen wir vor allem die Fragen anschauen, auf die er mit seinem Wirken eine Antwort zu geben versucht hat. // Es ist erstens die nationale Frage, das heißt, in welcher Form kann und soll Deutschland geeint sein? // Es ist zweitens die internationale Frage: Welchen Platz soll Deutschland in der Welt einnehmen, im europäischen Gleichgewicht der Mächte? // Es ist drittens die innenpolitische Frage: Wie soll das Land aussehen, wie kann innerer Frieden hergestellt werden, wie soll seine kulturelle und besonders seine soziale Verfassung aussehen? // Diese Fragen - wir spüren es - sind nicht einfach historisch überholt. Wir erkennen darin - natürlich verwandelt und mit anderen Vorzeichen - Konturen unserer heutigen Fragen wieder. // So wie immer wieder über die Gestaltung von Einheit in Vielfalt nachgedacht wird - Stichwort Föderalismusreform -, so wie wir über Deutschlands Rolle in Europa und in der Welt immer wieder neu nachdenken, so beschäftigt uns auch die innere Gestaltung unseres Gemeinwesens, das heute durch Einwanderung und demographischen Wandel vor neuen kulturellen und sozialen Herausforderungen steht. // Beispielhaft ist Bismarcks Energie, sein politischer Wille und seine Leidenschaft, sich so wesentlichen Fragen seiner Zeit zu stellen. Beispielhaft seine Fähigkeit, den richtigen Moment abwarten zu können, beispielhaft auch seine Entschlusskraft und seine Standhaftigkeit. // Wir werden natürlich den Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen, anders begegnen, ja anders begegnen müssen als Bismarck. Aber nicht deshalb, weil er das Land auf einen abschüssigen Weg geführt hätte. Nein: Es führt eben kein gerader Weg von Bismarck zu Hitler, wie gelegentlich behauptet worden ist. Das ist nicht nur eine unhistorische Spekulation, sondern auch eine ungerechte Beurteilung oder besser: Verurteilung eines Strategen, dem es doch nie um schlichtes Vormachtstreben oder gar so etwas wie ein "Großdeutsches Reich" ging. // Aber was für ihn noch quasi legitime politische Manöver waren, wie etwa Kriege zu führen, um innenpolitische Ziele zu verfolgen oder außenpolitische Interessen zu wahren, das kommt für uns selbstverständlich nicht mehr in Frage - und wo das heute noch anderenorts geschieht, da müssen wir Protest einlegen und nötigenfalls auch Hilfe oder Widerstand leisten. // Die Einheit des Reiches so zu gestalten, dass sich auch die Kleinen nicht übervorteilt fühlen, und dass ein gerechter Ausgleich geschaffen wird, darauf hat Bismarck immer geachtet - und manch einer sieht das als vorbildlich für Europa und dessen Einigungsprozess an, der im gerechten Ausgleich der Einzelinteressen und unter Wahrung der Interessen auch der kleineren Partner gestaltet werden soll. // Eine besondere List der Geschichte ist wohlbekannt, sozusagen die Dialektik des Paternalismus: Um seine sozialistischen Gegner zu bekämpfen, schuf Bismarck die damals weltweit fortschrittlichste Sozialgesetzgebung. Das hat Deutschland nachhaltig geprägt. Gerade die Bismarckzeit zeigt, dass sich soziale Sicherheit und dynamische wirtschaftliche Entwicklung nicht ausschließen, sondern dass sie im Gegenteil einander stärken können und sollten. Inzwischen haben wir allerdings auch gelernt, ohne Bevormundung von oben eine partnerschaftlich strukturierte, soziale Marktwirtschaft zu gestalten. // Ein bleibender Schatten auf Bismarcks Wirken ist sein hartnäckiger, auch unbelehrbarer Drang, Reichsfeinde zu identifizieren und möglichst auszuschließen, namentlich natürlich Katholiken und dann Sozialisten. Zeitgenossen mit Rang und Namen haben ihn dabei unterstützt. Das war er nicht allein. Das war nicht nur kontraproduktiv, es hat auch lange nachwirkende Wunden geschlagen und Vorurteile auf Jahrzehnte befestigt. // Wie lange mussten sich zum Beispiel auch Sozialdemokraten, bis hin zu Willy Brandt, noch als "vaterlandslose Gesellen" oder die katholische Kirche in Deutschland sich als Vertreterin einer "auswärtigen Macht" bezeichnen lassen! Das war Bismarck'sches Denken in Feindbildern. Wir dürfen es durchaus so formulieren, auch wenn Bismarck selbst die eben genannten Frontlinien später nivellierte, wenn er etwa mit dem Zentrum einen Modus Vivendi fand, der sich auf lange Sicht positiv auf das Miteinander in Deutschland auswirken sollte. // Der Blick auf die Bismarck-Ära zeigt uns, wie wichtig es war, dass die frühe Bundesrepublik eine Gesellschaft zu errichten vermochte, in der die Gräben zwischen den Kulturen und Religionen und - sagen wir es mit einem Wort von damals - den Klassen nicht vertieft, sondern überbrückt oder gar überwunden worden ist. // Bismarcks "Revolution von oben", wie man sein Werk genannt hat, hat damals eine historisch lang wirkende und tiefgreifende Antwort gegeben auf die große Frage der Epoche nach dem Ort und der Gestalt Deutschlands. // Wir stehen heute vor ähnlichen großen Fragen. Unsere Antworten werden andere sein. Aber den Mut, sich mit Tatkraft und Optimismus diesen Herausforderungen zu stellen, den können wir von ihm lernen.
-
Joachim Gauck
Angesichts dieses in jeder Hinsicht herausragenden Gästekreises möchte ich Sie alle - gewissermaßen praemissis praemittendis - als Freunde und Wegbegleiter des Jubilars ganz herzlich willkommen heißen. // Wenn der Bundespräsident eine Tischrede zu Ehren von Helmut Schmidt hält, dann sieht er sich vor eine doppelte Herausforderung gestellt. Zum einen ist schon so viel über den Staatsmann und politischen Publizisten, den Menschen Helmut Schmidt gesagt worden, dass der Jubilar, der Redner und die Zuhörer die Wiederholung fürchten müssen. Zudem ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit, alle Verdienste Helmut Schmidts in einer menschenfreundlichen und dazu noch protokollarisch vorgegebenen Zeit zu würdigen und dabei dann auch noch seiner Persönlichkeit nur annähernd gerecht zu werden. // Ich möchte Ihnen deshalb an diesem heutigen Abend nur das mitteilen und sagen, was mich persönlich an Helmut Schmidt beeindruckt hat, in all den Jahren, in denen ich sein Wirken aus der Ferne und Nähe nun verfolge. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich mit dem Weg zur deutschen Einheit beginne. // Das erste Mal bin ich Ihnen, lieber Herr Schmidt, in Rostock begegnet, meiner Heimatstadt, das war auf dem Kirchentag im Juni 1988, wie auch Ihnen, liebe Frau Hamm-Brücher, Sie waren auch dort. Damals, als Deutschland und Europa noch geteilt waren, die Zeit der Perestroika aber bereits angebrochen war, damals hielten Sie eine Rede in der Rostocker Marienkirche, allem Widerstreben der SED zum Trotz. Denn erst nach hartnäckigen und zähen Verhandlungen und Zurückweisung der Forderung der SED, wir, Kirche und Kirchentag, sollten Sie wieder ausladen, was wir nicht taten, sind Sie dann doch nach Rostock gekommen. Weit mehr als 2.500 Menschen waren damals in die Marienkirche gekommen, um Ihnen zuzuhören, und man empfing Sie so, wie man eben ein Idol empfängt. Ein Offizier der Stasi fasste das, was sich bei Ihrer Begrüßung abspielte, laut Stasi-Akten in fünf Wörtern zusammen: "Jubelrufe, lang anhaltender stürmischer Beifall." // Ihre Rede damals gab der Christen- und Bürgergemeinde Kraft. Es war vor allem ein Satz, der vielen, die dabei waren, in Erinnerung geblieben ist. Sie sagten damals: "Jeder von uns weiß, dass wir eine Aufhebung der Teilung nicht erzwingen können. ( ) Und trotzdem darf jeder von uns an seiner Hoffnung auf ein gemeinsames Dach über der deutschen Nation festhalten." Was wir damals noch nicht wussten: Genau in dieser Kirche versammelten sich dann ein Jahr später, 1989, die Rostocker, um jeden Donnerstag mit dem Wort Gottes und den neuen politischen Programmen gegen die kommunistische Diktatur zu protestieren. Und während sie das taten, verwandelten sie sich von Untertanen in Bürger. // Damals hat sich eine Hoffnung erfüllt, zu der wir 1988 noch gar kein rechtes Zutrauen hatten. Seitdem hat sich unendlich viel verändert. Eines aber, lieber Helmut Schmidt, ist unverändert geblieben: Auch heute hören Ihnen die Menschen zu, auch heute bringen sie Ihnen großen Respekt entgegen. Einer Umfrage zufolge sind Sie sogar "das größte lebende Vorbild der Deutschen". // Schon viele haben versucht, das Phänomen Helmut Schmidt zu ergründen. Ich will mich da lieber nicht einreihen. Was ich aber tun möchte, ist, Ihnen zu sagen, warum ich mich freue, Sie heute hier in Schloss Bellevue zu Gast zu haben. Ich freue mich, weil ich Ihre Erfahrung schätze, Ihre politische Urteilskraft und Ihre geistige Unabhängigkeit. Und weil viele Stationen Ihres Lebens auch für mich bedeutsam waren, als Bewohner der DDR und später als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, die fast ein ganzes Jahrhundert erlebt und reflektiert hat."Unser Jahrhundert" - so nannten Sie Ihre Rückschau, die Sie zusammen mit Fritz Stern 2010 veröffentlicht haben. Uns begegnet ein Mann mit republikanischen Werten - zuvörderst aber mit einem deutlichen Ja zu politischer Verantwortung und ausgestattet mit einer im politischen Raum nicht eben häufigen Tugend, dem Mut. // Besonders beeindruckend finde ich, wie offen Sie im Rückblick auch über schwierige Gewissensentscheidungen gesprochen haben. Noch im Zweiten Weltkrieg, in dem Sie als Offizier der Wehrmacht kämpften, standen Sie vor der quälenden Frage: Wann endet die Pflicht zum Gehorsam gegenüber dem Staat, wann beginnt die individuelle Verantwortung und wo die Schuld? // Die Erfahrungen von nationalistischer Hybris, von Krieg und Massenmord haben Sie, wie viele Zeitgenossen, zu einem überzeugten Europäer gemacht. Bei Ihrem Geburtstagsfest im Hamburger Thalia Theater sagten Sie Anfang des Jahres: "Ich wünsche mir, dass die Deutschen begreifen, dass die Europäische Union vervollständigt werden muss - und nicht, dass wir uns über sie erheben." Dass Sie dies sagten, gerade Sie, das hat Gewicht. Ich bin mir sicher: Ihre Denkanstöße leisten einen wichtigen Beitrag, im Vorfeld der Europawahlen im Mai und hoffentlich weit darüber hinaus. // Lassen Sie mich noch einmal zurückschauen in eine schwierige Phase Ihres Lebens. // Als Bundeskanzler sahen Sie sich, vor allem im "Deutschen Herbst" des Jahres 1977, mit dem Terrorismus der Roten Armee Fraktion konfrontiert und vor die Frage gestellt: Darf sich ein demokratischer Staat erpressen lassen, darf er Gefangene gegen Geiseln austauschen? Was soll man tun, wenn die Staatsräson in Konflikt gerät mit dem Leben von Einzelnen? Sie haben damals mit Ihrem Gewissen gerungen, und ich bewundere Sie für einen Satz, der so einfach klingt und einem doch so schwer über die Lippen kommt: Er lautet: "Ich bin verstrickt in Schuld." // Dies sehr klar zu erkennen und zu benennen und gleichwohl die beständige Pflicht zum Handeln zu akzeptieren, zeichnet einen großen Politiker aus. // Lieber Herr Schmidt, Sie haben immer wieder Mut und Pflichtbewusstsein, Führungskraft und Standfestigkeit bewiesen, auch in Situationen, die Sie persönlich und politisch an Ihre Grenzen brachten. Der NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel war im ganzen Land, auch in Ihrer Partei, der SPD, heftig umstritten - aber die Geschichte hat Ihnen Recht gegeben. Sie haben erlebt, wie es ist, wenn man in der Politik nicht wegen eines Versagens, sondern wegen einer politischen Entscheidung plötzlich den Rückhalt verliert, wenn es einsam wird auf dem Gipfel der Macht. Sie haben auch erlebt, was es ausmacht, die Gestaltungsmacht zu verlieren und die Regierungsverantwortung dann dem politischen Gegner zu überlassen. Sie kennen den bitteren Geschmack der politischen Niederlage. Sie wissen besser als ich, dass solche Lebensphasen auch eine Einladung enthalten. Eine dunkle Einladung zu Fatalismus, Pessimismus oder gar zu Zynismus. // Sollte Ihre Psyche jemals solche Einladungen erhalten haben, so haben Sie es vermocht, sie auszuschlagen. // Später, außer Dienst, als politischer Publizist und Herausgeber der ZEIT, haben Sie sich immer wieder in die öffentlichen Debatten eingemischt, und das tun Sie bis heute. Ihre Überlegungen zum Verhältnis von Politik und Moral, orientiert an Ihren vier"Hausapothekern" Marc Aurel, Immanuel Kant, Max Weber und Karl Popper, haben das politische Denken dieses Landes beeinflusst. Sie sind ein Verteidiger unseres parlamentarischen Systems, der nicht müde wird, den friedlichen Meinungsstreit und den Kompromiss als demokratische Tugenden zu würdigen und für pragmatische, verantwortungsvolle Politik zu werben. // Wer Ihr publizistisches und politisches Lebenswerk in der Gesamtschau betrachtet, der ist überwältigt von der thematischen Vielfalt. Einer Ihrer"Hausapotheker", Marc Aurel, dessen "Selbstbetrachtungen" Sie als Soldat stets im Tornister trugen, hat einmal geschrieben: "Tue nichts widerwillig, nichts ohne Rücksicht aufs allgemeine Beste, nichts übereilt, nichts im Getriebe der Leidenschaft." Das klingt in meinen Ohren - verzeihen Sie - stark nach Helmut Schmidt - nach einem Mann, der sich ganz der Sache hingibt, sorgfältig arbeitet, auch viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Ein Arbeitsethos übrigens, das auch geeignet ist, einem gefährlichen Vorurteil zu begegnen: dem Vorurteil nämlich, Politik sei ein dubioses Geschäft, das vor allen Dingen von Leichtgewichten betrieben werde. // Fleiß, Pflicht und Vernunft, Weber und Kant, das alles klingt erst mal kühl, rational, streng. Ich glaube, zu Ihrer Beliebtheit heute hat ebenso eine andere Seite Ihrer Persönlichkeit beigetragen, die es seit langem gibt. Ich meine den Mut, die eigene Meinung deutlich und ohne andauernde Rückversicherung zu sagen. Manchmal durchaus eigensinnig, dann wieder hinreißend sozialdemokratisch. Ein Weltbürger mit universellen Interessen - und zugleich immer in Hamburg-Langenhorn -, bodenständig und beständig brahmseeverbunden. Ich schweige von Sturheit, möglicherweise norddeutsch, denn ich möchte nicht vom Rauchen sprechen. // Lieber Herr Schmidt, nun zum Schluss muss dann aber der Satz kommen, auf den ich mich schon lange gefreut habe und den ich als Präsident der Bundesrepublik Deutschland mit großer Dankbarkeit ausspreche: Sie haben sich verdient gemacht um unser Land. Ihr tätiges Leben für unsere Republik, Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - all das macht Sie zu einem Vorbild für aktuelle und künftige Politikergenerationen. Die Demokratie braucht Menschen wie Sie. // Bitte erheben Sie Ihr Glas auf Helmut Schmidt und Frau Ruth Loah. Auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohl!
-
Joachim Gauck
Auf einem Historikertag darf man doch sicher mit einem Kaiser beginnen. Ich beginne mit dem letzten deutschen Kaiser, Franz Beckenbauer. Er erzählt gelegentlich von einem Ereignis, bei dem er selber ausnahmsweise einmal Verlierer war. Es handelt sich um das Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 1974, genauer gesagt in der Bundesrepublik Deutschland, bei dem die Auswahl der DDR gegen die der Bundesrepublik 1:0 gewann. // Franz Beckenbauer soll dann, wie auch andere Akteure damals, immer sinngemäß gesagt haben: "Ohne die Niederlage gegen die DDR wären wir '74 nie Weltmeister geworden. Denn nur dadurch wurden wir radikal mit unseren Schwächen konfrontiert, die wir dann in der Folge abstellen konnten". Also: Eine schmähliche Niederlage, ausgerechnet gegen die DDR, bereitete für die Mannschaft der Bundesrepublik den großen Triumph, die Weltmeisterschaft vor. // Ich erzähle diese deutsch-deutsche Sportanekdote natürlich, weil sie auf direkte und einschlägige Weise zum Thema passt, das Sie sich gegeben haben, wenn Sie hier auf dem 50. Deutschen Historikertag über Gewinner und Verlierer sprechen wollen. Ich gestehe, dass mich dieses Thema naturgemäß sehr fasziniert, und mich interessiert daran besonders der immer wieder - nicht nur im Sport - zu beobachtende dialektische Umschlag zwischen Sieg und Niederlage. // Bevor ich näher darauf zu sprechen komme, zunächst ein Wort zum heutigen Anlass und zum heutigen Ort: Göttingen. // "In Göttingen schien die Sonne." So beginnt Walter Kempowski in seinem Roman "Herzlich Willkommen" die Kapitel, die von der Studentenzeit des Erzählers handeln. // "In Göttingen schien die Sonne": Dieser oberflächlich so schlichte Satz ist die Überschrift über ein ganz neues Leben für jenen nicht mehr so ganz jungen Erzähler. Als Kind hatte er den Krieg und die Nazizeit erlebt und die Zerstörung seiner - und übrigens auch meiner - Heimatstadt Rostock, er hatte den Verlust allen Familienbesitzes erlitten, und war dann selber von der sowjetischen Besatzungsmacht aus politischen Gründen gefangen und gequält worden, hatte acht Jahre Zuchthaus in Bautzen erlebt, mit Einzelhaft. All das hatte er hinter sich. Und zudem musste er mit der Schuld leben, dass durch ihn auch seine Mutter und sein Bruder in Haft gekommen waren. Kurz: Er hatte selber schon genügend Geschichte, ja, sogar Weltgeschichte am eigenen Leib erlebt und erlitten. // Der kommt nun, Mitte der 1950er Jahre, hierher ins sonnenbeschienene Göttingen, in die bemüht heile Welt der westlich-westdeutschen Nachkriegszeit, um an der Pädagogischen Hochschule zu studieren, unter anderem Geschichte - dort ausgerechnet, wo die Geschichte nicht nur stillzustehen, sondern, wie er findet, gar nicht stattgefunden zu haben scheint: "Göttingen, das war eine Stadt, als wenn nichts gewesen wäre, eine Stadt, so wie man sie in älteren Fotobänden abgebildet sieht, in Brauntönen, Fachwerkgassen im Gegenlicht." // Nun wissen wir heute, dass auch in Göttingen die Zeit nie stehen geblieben ist. Auch das ehemals so beschauliche Städtchen beherbergt heute eine Universität mit bald 30.000 Studentinnen und Studenten. Das wollen wir in diesem Zusammenhang gern erwähnen, und die Universität und die Stadt sind stolz darauf, diesen Historikertag hier mit all den Gästen zu begehen. Ein fast unüberschaubares Programm wartet auf Sie, die rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dass auch die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft gigantische Fabrikationsstätten historischen Wissens und historischer Publikation geworden sind, wird uns bei einem solchen Anlass recht deutlich bewusst. Das alles ist beeindruckend, und ich freue mich, bei Ihnen zu sein und wünsche Ihnen viel Erfolg. // Alles auf Erden ist Geschichte, alles hat Geschichte. Aber was gewinnen wir eigentlich, wenn wir uns damit befassen? Ist es nicht belastend oder gar kränkend, wenn wir uns vor Augen führen, dass nichts denkbar ist ohne ein Vorher, und dieses Vorher, das haben nicht wir, sondern andere gemacht? Lange vor uns sind Entscheidungen getroffen worden, die auch uns binden, obwohl wir nicht dazu gehört wurden. Dazu zählt auch Schuld, die wir nicht selber auf uns geladen haben, an der wir aber heute noch zu tragen haben. // Aber was vor uns geschah, ist oft ja auch Wohltat und Gewinn: Lange vor uns sind die Kämpfe ausgetragen worden, die uns auch heute noch Freiheiten schenken, für die wir selber nicht streiten mussten. Lange vor uns sind die Leistungen erbracht worden, aufgrund derer wir heute Wohlstand, Frieden und Sicherheit genießen. // Es gibt also, auch in den Zeiten der scheinbar generellen Machbarkeit und des Anspruchs auf unbedingte individuelle Autonomie, so etwas wie ein Schicksal, etwas Unverfügbares, von dem sich niemand voll und ganz emanzipieren kann. // Aber genau hier erscheint dann die wirkliche Aufgabe. Zwar sind wir für unsere Vergangenheit nicht verantwortlich, für den Umgang mit ihr aber allemal. Und ist es nicht dieser Umgang, der oftmals darüber entscheidet, wie wir unsere Gegenwart und Zukunft zu gestalten vermögen? // Wir haben zwar unsere Vorgeschichte nicht gemacht, wir können nichts dafür, wie sie verlaufen ist, dafür glauben wir aber, dass wir besser als unsere Vorfahren wissen, was zum Beispiel an ihren Entscheidungen falsch und was richtig gewesen ist. Wir haben - wie wir denken, und sicher oft zu recht - bessere und tiefere Einsichten. Und wir können oft nur den Kopf schütteln über die Einstellungen, Urteile und eben auch über die Entscheidungen von früher. Wir sind sozusagen kognitive Geschichtsgewinner oder vielmehr: Wir könnten es sein, wenn wir bereit sind zu lernen und genau hinzuschauen. // Nehmen wir nur die Beispiele, die die großen Gedenktage des laufenden Jahres bieten, allen voran der 100 Jahre zurückliegende Beginn des Ersten Weltkrieges. In aller Deutlichkeit sehen wir heute, dass damals auf allen Seiten weitgehende Wahrnehmungsverweigerungen geherrscht haben müssen, die bis zu partieller Blindheit gingen. // Heute sehen wir eine Unfähigkeit, Folgen bestimmter Entscheidungen in den Blick zu nehmen. Oder wir erkennen auch heute eine zynische Einstellung der Herrschenden oder Befehlenden gegenüber dem Leid der Untertanen. // Auch erblicken wir eine maßlose Selbstüberschätzung und eine unbedachte Bereitwilligkeit, die Katastrophe in Kauf zu nehmen und das alte Europa eine "Welt von gestern" werden, also untergehen zu lassen. // Extrem unverständlich erscheint es uns heute, dass die Eliten von 1914 den Krieg als reinigendes Feuer empfinden konnten, dass ihr Unbehagen oder ihr Überdruss gegenüber der Moderne positive Untergangsphantasien hervorbringen konnte, ohne dass Einigkeit auch nur über die Konturen einer "neuen" Welt geherrscht hätte. // Ebenso sehen wir heute, um nur ein Beispiel aus einem anderen Zeitabschnitt zu nennen, welche Fehler zum Beispiel die Westmächte vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges gemacht haben: Genannt wird dann oft das Münchner Abkommen mit Hitler. // Aber wissen wir es wirklich besser als die Akteure von damals? Oder wissen wir lediglich mehr, nämlich wie die Geschichte weiterging? Im Augenblick des Geschehens kann niemand die Geschichte des Geschehens selber erzählen. Robert Musil, der im Ersten Weltkrieg Teilnehmer an den so absurden wie barbarischen Dolomitenschlachten war, hielt sarkastisch fest: "So also sieht Weltgeschichte in der Nähe aus; man sieht nichts." // Nur weil wir später dran sind, können wir heute die Geschichte erzählen. Und erzählen heißt ja, einen sinnvollen, plausiblen Zusammenhang zwischen den Fakten und den Ereignissen herzustellen. // Beides ist übrigens wichtig: Wenn die Historiker einerseits penibel und klar Fakten ermitteln und erforschen, Quellen aufsuchen und präsentieren, und wenn sie andererseits Geschichte in Geschichten zu erzählen wissen, die uns Sinn erschließen können durch eine bestimmte Perspektive der Erzählung. Gerade dieses Erzählen kann die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und auf diese Weise auch ethische und politische Fragen an uns heute stellen. // Dass wir heute vieles genauer sehen können, weil wir später dran sind, das darf uns nicht zu Besserwisserei und Hochmut verleiten. Im Gegenteil: Als kognitive Geschichtsgewinner lernen wir Skepsis und gewinnen die ständige Bereitschaft zur Überprüfung unseres eigenen gegenwärtigen Handelns. Wenn zum Beispiel, wie wir immer wieder feststellen, unsere Vorfahren von Vorurteilen geleitet wurden oder intellektuellen Moden folgten: Mit welchem Recht und mit welcher Sicherheit können wir eigentlich glauben, dass wir nicht selber zeitgeistigen Plausibilitäten oder schlichten Fehlurteilen aufsitzen? Es besteht aber genauso die Gefahr, dass Geschichte ideologisch missbraucht oder instrumentalisiert wird. // Mir ist zum Beispiel in Erinnerung, dass nicht nur Teile der Medien, sondern auch Lehre und Forschung im Westen die Erfahrungen mit der konkreten kommunistischen Herrschaft, die Konstruktion von der Ohnmacht der Vielen und der Übermacht der Wenigen nur unzureichend darzustellen vermochten. // Das gewinnen wir in der Beschäftigung mit der Geschichte: Skepsis und kritisches Bewusstsein. Wenn die Geschichte auch nur selten eindeutige Handlungsoptionen für die Gegenwart bereitstellen kann, die sich aus historischer Erfahrung gleichsam von selber ergeben, so kann sie uns doch vor Selbstgefälligkeit und Unbelehrbarkeit warnen. // Historisch gebildet zu sein, das heißt doch eigentlich: seiner Endlichkeit, seiner Fehlbarkeit und der Offenheit der Geschichte eingedenk zu sein. Wer so historisch reflektiert lebt, der denkt zweimal nach, bevor er handelt, und er bemüht sich, mit Einsicht in das Notwendige zu handeln, mit Rücksicht auf die anderen und mit Hinsicht auf die denkbaren Folgen, auch die sogenannten unwahrscheinlichen. // Eines lernen wir aus der Geschichte auf jeden Fall: Es gibt, und damit sind wir wieder hier, bei Ihrem Thema, es gibt meistens Gewinner und Verlierer. Wir sollten uns nicht lange mit Klagen darüber aufhalten, dass das so ist, sondern fragen: Wie geht der Verlierer mit dem Verlieren, der Gewinner mit dem Gewinnen um? Und auch: Wie verhält sich der Verlierer zum Gewinner und der Gewinner zum Verlierer? // Kommen wir zunächst auf den jungen Mann zurück, der, ohne Zweifel ein Verlierer, schwer geprüft nach Göttingen kommt, wo für ihn, nach all der erlebten Lebensfinsternis, die Sonne scheint. Was macht er hier? Hadert er endlos mit dem unverdienten Schicksal? Sinnt er auf Rache? Reicht es ihm aus, alle Welt seine Verletzungen spüren zu lassen? Nein, so ist es nicht. Er lässt sich ganz auf Neues ein, er ist sehnsüchtig nach neuer Erfahrung, nach Leben, nach Lernen, nach Liebe. Er - und man darf und soll in dem Erzähler Kempowski selber erkennen - er bleibt nicht der Gefangene seiner Vergangenheit. Indem er sie gestaltet, wird er zum Gewinner: Er schreibt die Erinnerungen an seine Gefangenschaft auf, er führt Interviews mit seiner Mutter und mit Verwandten, er sammelt die verlorenen Bücher seiner Kindheit. Er, der schuldlos acht Jahre seines Lebens im Zuchthaus verloren hat, wird später zu einem unermüdlichen Sammler, zum Historiker und Erzähler, zuerst seiner selbst, dann seiner Familiengeschichte, dann der Geschichte der Deutschen in diesem Jahrhundert. // Aus dem Verlierer, aus dem Opfer wird aus eigener innerer Kraft der Schriftsteller Walter Kempowski, der mit dem "Echolot" und der "Deutschen Chronik" ein Werk schafft, das auch international seinesgleichen sucht. Der unter die Räder der Geschichte geraten war, zum Objekt der Mächtigen, hat sich selber zum Schöpfer und zum Subjekt seiner Geschichte und der seines Volkes geschrieben. Sieht so ein Verlierer aus oder - ob zwar gezeichnet und unter die "gebrannten Kinder" zu rechnen - nicht eben doch ein Gewinner? // Was am Beispiel dieses Einzelnen zu zeigen ist, das gilt auch für Nationen, für Völker oder Völkergruppen. Wo steht denn geschrieben, dass Verlierer Verlierer bleiben müssen? Und kommt es nicht tatsächlich alles darauf an, wie im Nachhinein mit der Niederlage umgegangen wird - wie im Übrigen auch mit dem Sieg? // Achten wir beim Nachdenken darüber nicht nur auf bewaffnete Konflikte, sondern auch auf andere Entwicklungen, die von Siegern und Verlierern sprechen lassen. // Da ist zum Beispiel die Geschichte der Industrialisierung. Uns steht einerseits die Rasanz des Fortschritts vor Augen, mit den Eisenbahnen, den großen Fabriken, die allüberall entstehen, den Erfindungen des Funks zum Beispiel, dem Verlegen der ersten Seekabel, und so weiter - und andererseits wissen wir doch alle um die Berichte über das erbärmliche soziale Elend, ob sie nun geschrieben waren von Friedrich Engels über "die Lage der arbeitenden Klasse in England" oder ob es die Protokolle des evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern sind, der über die himmelschreiende Not der Ärmsten in Hamburg berichtete. // Da gab es ohne jeden Zweifel echte Verlierer, und es gab Verlorene und Mühselige und Beladene, Erniedrigte und Beleidigte. Und doch war diese Entwicklungsphase auf lange Sicht ein wichtiger Ausgangspunkt für eine unglaubliche Verbesserung der Lebensumstände für alle, an der viele mitwirkten und die weltgeschichtlich ohne Beispiel ist. Zugespitzt gefragt: Hat ein König um 1800 so leben können wie der durchschnittliche Europäer im Jahre 2014? Nie hat es sich - in diesem Teil der Erde, in dem wir leben dürfen - leichter und angenehmer leben lassen, nie konnten vor allem Krankheit und Armut besser bekämpft werden als heute. Und - schauen wir wieder zurück - durch die sozialistische Arbeiterbewegung, durch christliche Gesellschaftslehre, durch demokratische Parteien und Gewerkschaften haben der Arbeiter und der sogenannte "kleine Mann" Recht, Würde und Stimme bekommen. Ob das Wissen darum, dass das passieren würde, ein Trost gewesen wäre für die damaligen Verlierer der Geschichte, das steht auf einem anderen Blatt, einem Blatt, das ich etwas später gesondert aufschlagen werde. // Gewinner und Verlierer: Manchmal changiert das Bild, der Verlierer sieht wie der Sieger aus oder umgekehrt. // Wir sprechen zum Beispiel in Westeuropa vom Ersten Weltkrieg als der "Urkatastrophe" des Jahrhunderts - und zwar unabhängig davon, ob wir in England oder Frankreich zu den Siegern oder ob wir in Deutschland zu den Verlierern des Krieges gehören. Bei anderen Kriegsteilnehmern aber denkt man ganz anders. // Ich hatte vor kurzem acht Historiker aus acht europäischen Ländern zu einer Diskussionsveranstaltung ins Schloss Bellevue eingeladen. Es ging um die Frage, wie in den verschiedenen Ländern heute an den Ersten Weltkrieg erinnert wird. Dabei wurde vollkommen klar, dass die Polen oder die Tschechen und Slowaken oder auch Serben oder Kroaten, Esten, Letten und Litauer keineswegs von einer Urkatastrophe sprechen, da doch ihre Staaten oder Staatenbünde erst durch den Ersten Weltkrieg und nach dem Zerfall der Großreiche gegründet oder wiedergegründet werden konnten. Die neuen Nationen sind also Gewinner, obwohl die aus ihnen stammenden Soldaten zum Teil oft auf Seiten der Verlierer-Imperien gekämpft hatten. // Und wie geht man mit dem Verlieren um? Nehmen wir unser Land, Deutschland. Der erste Blick nach 1918: Auf der einen Seite spüren die Deutschen damals so etwas wie ein Aufatmen, als mit der Niederlage im November endlich die Republik und die Demokratie kommen. Aber nicht alle haben dieselben Gefühle. Alle aber drücken schwer die Reparationen, die der Versailler Vertrag, der auch von Ressentiment und Rache geprägt war, dem Land auferlegt hat. Und es drückt schwer die als ungerecht empfundene Behauptung, der Alleinschuldige am Krieg gewesen zu sein. Und man glaubt nicht an die Realität der militärischen Niederlage. Man lügt sich das Gegenteil vor und behauptet und tröstet sich mit der Legende: der vom Dolchstoß. // Diese Hypothek, so wissen wir es alle, lastet schwer auf der jungen Republik, bei allem guten Willen und aller aufrichtigen Anstrengung besonnener und überzeugter Demokraten. Zu viele bleiben damals abseits. Trotz "roaring twenties" und großer Aufschwünge in den goldenen Zeiten vergraben sich viele in Gram und hadern verstockt mit dem Schicksal. Andere sind einfach nur verelendet. Die soziale Not der Wirtschaftskrise tut ein Übriges. Rachephantasien wachsen, andere Schuldige werden gesucht und gefunden: mal sind es Juden oder Bolschewisten, für manchen schlicht die Demokratie, die einige Verächter schlicht "das System" schimpfen. Eine Selbstvergewisserung mit klarem Blick für die tatsächlichen Gegebenheiten bleibt größtenteils aus. Von rechts und links wird die schwache Republik angegriffen und verraten. So erobern Hitler und die Nazis ein Land, das nicht mit sich ins Reine gekommen war. // Wie anders geht das Land nach 1945 mit der Niederlage um! Da blieb kein Raum für Lebenslügen wie 1918. Und die, die es versucht haben, sind mit diesem Versuch gescheitert. Militärisch war Deutschland eindeutig besiegt und moralisch, auch nach eigener schmerzhafter Einsicht einiger, später dann vieler seiner Bürger, zutiefst diskreditiert. Weder der Verlust von Gebieten noch Reparationszahlungen führten zu so bedeutenden revanchistischen Kräften, dass sie dauerhaft politisch durchsetzungsfähig gewesen wären. Aber das Land konnte mit der Niederlage auch deshalb anders umgehen, weil es von den Siegern anders behandelt wurde, also schon bald wieder in den Kreis der möglichen, dann der tatsächlichen Partner aufgenommen wurde. Zwar stellen der beginnende Kalte Krieg und die Aufteilung des Landes in zwei Blöcke eine besondere Situation dar, aber zumindest im Westen wurden Chancen geboten, gesehen und ergriffen. // Eine entschiedene Haltung der ausgestreckten Hand seitens der Sieger hat - zunächst für einen Teil unseres Landes - zu einer glücklichen neuen Geschichte geführt. Schon 1944 hatte das Britische Foreign Office für die britischen Soldaten, die nach Deutschland gehen sollten, in diesem Geist einen Leitfaden geschrieben, der noch heute lesenswert ist. Die Haltung lässt sich zusammenfassen in der Aufforderung: Be smart, be firm, be fair. Oder ausführlicher: "Es ist gut für die Deutschen, wenn sie sehen, dass Soldaten der britischen Demokratie gelassen und selbstbewusst sind, dass sie im Umgang mit einer besiegten Nation streng, aber zugleich auch fair und anständig sein können. Die Deutschen müssen selber fair und anständig werden, wenn wir später mit ihnen in Frieden leben wollen." // Ich versage mir an dieser Stelle einen Exkurs darüber, dass die Besiegten der sowjetischen Besatzungszone weder freundliche Sieger noch eine erfreuliche Zukunftsperspektive hatten. Das muss ich auslassen, denn in diesem Falle würde ja der größte Gegner der Historikerzunft, nämlich der Zeitzeuge, auf der Bühne stehen. // Umso größer ist mein Respekt für eine Haltung, die den gegenwärtigen Feind schon als künftigen Partner sieht. Sie verhindert die Perpetuierung von Sieg und Niederlage, von Rache und Vergeltung, und sie wird so einem neuem Krieg oder der Bereitschaft, ihn zu führen, vorbeugen. // Von ähnlicher Art waren im Übrigen die Friedensschlüsse von Münster und Osnabrück, die 1648 den Dreißigjährigen Krieg beendeten und auch die Friedensordnung des Wiener Kongresses 1815, also vor bald genau 200 Jahren. Man ersparte sich das Aufrechnen, auch die moralische Verurteilung des Feindes. So schuf man, im Gegensatz zu Versailles, eine Friedensordnung, die fast 100 Jahre hielt. Allerdings gab es auch hier neue Verlierer, nun waren sie im Innern der Staaten. Denn die neue Internationale der Fürstenhäuser, die in weiten Teilen die alte geblieben war, sicherte ihren Frieden auch gegen die freiheitlichen Bestrebungen ihrer eigenen Bürger. Ich bin dankbar, dass vorhin die Göttinger Sieben erwähnt wurden - anderer Zeitzusammenhang, aber dasselbe Problem. // Ein anderes Beispiel: Nach 1945 konnte eine Gruppe aus unserer Bevölkerung, die sich nach dem jüngsten Krieg ganz besonders als Verlierer fühlen musste, die Chance ergreifen, zu Gewinnern zu werden. Ich spreche von den Flüchtlingen und Vertriebenen, die zu Millionen ihre Heimat, Haus und Hof, also praktisch alles verloren hatten. Sie hatten eine fundamentale Erfahrung gemacht: Was ihnen blieb, war nur ihr Können, ihre handwerklichen Fähigkeiten, ihr Fleiß, ihr Glaube, ihre Bildung. "Was du gelernt hast, kann dir keiner nehmen!" Diese Erfahrung wurde damals in vielen Familien weitergegeben. Und überdurchschnittlich viele von ihnen haben in der Nachkriegszeit weit überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse erzielt. Vieltausendfach sind hier Aufstiegsgeschichten zu erzählen, führte die persönliche Entfaltung sozusagen auf die Gewinnerstraße. // Dennoch, wir wissen es, konnten oder wollten manche den unwiederbringlichen Verlust ihrer Heimat und das erlittene Unrecht nicht akzeptieren. Andere, viele aber, fühlten sich einer besseren Zukunft in neuer Heimat verpflichtet und wurden so zu Wegbereitern der Verständigung mit unseren östlichen Nachbarn - und so noch einmal zu Gewinnern für unser Land. // Von Gewinnern und Verlierern hat man auch im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gesprochen. Ich kann das nur sehr bedingt nachvollziehen. Wo für alle Freiheit anbricht, wo für alle Freizügigkeit, Recht und demokratische Mitwirkung ermöglicht werden, wo für alle die Chancen eröffnet werden, sich frei zu entfalten, da kann doch vom Verlieren eigentlich nur reden, wer Privilegien eines Unrechtsstaates genossen hat. // Aber schauen wir genauer hin: Es existieren zweierlei Verlusterfahrungen. Neben der politisch gewollten Ablösung der politischen Eliten und ihres sehr kleinen Herrschaftszentrums musste eine sehr große Zahl Beschäftigter in Funktionseliten der öffentlichen Verwaltungen, des Parteiapparates, von Polizei, Militär und Geheimpolizei in eine unsichere Zukunft überwechseln. Dabei ist weniger der Verlust an materieller Sicherheit als der Verlust einer sich über zwei Generationen herausgebildeten Rollensicherheit von Bedeutung für die Lebensgefühle der Betroffenen. // Und auch wer sich als unpolitischer Zeitgenosse an die Defizite mit der Zeit gewöhnt hatte - und es gab eine ganze Sammlung von Defiziten -, wer sich privat in den berühmten "Nischen" ein lebbares Leben errichtet hatte, war dann, als sich alles änderte, häufig überfordert vom neuen System, reagierte also, wenn nicht mit Ablehnung des Neuen, so doch mit starken Fremdheitsgefühlen - und das besonders natürlich, wenn man seine Arbeit verloren hatte und das Gefühl hatte, nicht mehr wirklich gebraucht zu werden. Aber alles in allem sind die Deutschen und insbesondere die Ostdeutschen insgesamt Gewinner der Vereinigung. // In der Dialektik der Gewinner- und Verlierergeschichte werden immer wieder, wenn wir genauer hinschauen und etwas tiefer blicken, zwei Muster offenbar, die zu den grundlegenden abendländischen Erlebnis- und Erzählmustern gehören und die bis heute prägend sind. Sie haben beide eine religiöse, genauer, eine christliche Wurzel. // Da ist einmal die Geschichte des absoluten Verlierers, der, selber gewaltlos und friedlich, unschuldig verhaftet und sogar hingerichtet wird. Von den religiösen und staatlichen Autoritäten vernichtet. Seine Anhänger verzagt, verstreut, verloren. Doch wenig später entsteht in ihrem Kreis die Botschaft, er sei von den Toten auferweckt worden, also von Gott selber gerechtfertigt, von der höchsten Instanz. In dieser mythosgleichen Geschichte des Jesus aus Nazareth findet der denkbar größte Umschlag von Niederlage in Sieg statt. // Und diese Geschichte, sie trat nun selber einen Siegeszug an: erzählt zunächst von einer kleinen, verfolgten Verlierersekte, erobert sie Schritt für Schritt das römische Weltreich. Es war diese Geschichte und die mit ihr begründete Praxis der Nächstenliebe zu den Verlierern und Verlorenen, die ohne Gewalt, ohne politische Tricks, ohne strategische Planung plötzlich gegen alle anderen Geschichten gewann. Dass das unschuldige Leiden nicht vergeblich erlitten wurde, dass es einen Sinn hat und Rechtfertigung erfährt, das war eine Hoffnung, der sich Menschen seither gerne hingaben und hingeben. // Das andere, korrespondierende Muster der Geschichte vom Verlieren und doch Gewinnen, handelt vom selbst verschuldeten Leid. Diese individuelle Schuld- und Leidenserfahrung kann zu Einsicht, Reifung, dann zu Versöhnung und zu neuem Anfang führen - auch für sie gibt es eine Geschichte in der Bibel, etwa die, die vom verlorenen Sohn handelt. // Ob selbstverschuldet oder schuldlos erlitten: Leid muss nicht sinnlos sein, es kann zu Läuterung, Besinnung, neuem Selbstvertrauen führen. Bis heute lieben wir deshalb Geschichten, ob in Büchern oder Filmen, ob in der Oper oder im Theater, in denen die Helden ein schweres Schicksal erleiden, daran fast endgültig zu zerbrechen drohen und zu scheitern drohen, dann aber, vielleicht geläutert, vielleicht mit neuer Kraft und Stärke, alle Widrigkeiten besiegen und gleichsam wieder auferstehen, aufstehen. // An diese Erzähl- und Erlebnismuster muss ich denken, wenn ich mir und uns die Frage stelle: Was ist nun mit den Opfern, die keine neue Zukunft mehr hatten, was ist mit den wirklichen und endgültigen Verlierern, den Verlierern der Geschichte, die nicht erhöht wurden, die keine Chance zu einer Läuterung bekamen und denen jeder Triumph versagt blieb? Mit den Opfern von Völkermord und Holocaust, von Krieg, was ist mit den Opfern von Naturkatastrophen, Hungersnöten, Epidemien? Mit den unschuldig leidenden Kindern? Was ist mit denen, die ein metaphysischer Trost nicht erreicht, denen die gerade zitierten Geschichten von Tod und Auferstehung fremd oder unglaubwürdig, jedenfalls nicht zugänglich sind? // Hierauf, das weiß ich, können Historiker, aus ihrem Beruf heraus jedenfalls, keine Antwort geben. Die Frage nach dem Sinn von Leid, nach dem Sinn oder der Rechtfertigung von jedem einzelnen Leidenden, jedem einzelnen Opfer, sie kann nicht historisch beantwortet werden. // Aber diese Frage könnte nach meinem Verständnis doch die Geschichtsschreibung durchaus begleiten. Auch wenn die Geschichte, wie man sagt, von den Siegern geschrieben wird, ist doch immer auch die Geschichte der Marginalisierten zu erzählen, der Unterdrückten, der Geschlagenen. Und das geschieht doch auch schon. Es gibt doch schon einen erprobten Perspektivenwechsel. // Geschichtsschreibung kann ihnen keinen Sinn zusprechen, aber Geschichtsschreibung kann ihnen ihre Würde lassen, diesen Opfern, über die wir eben gesprochen haben. Sie kann ihnen ihre Würde lassen oder wiedergeben, wenn sie ihre Stimmen zu Wort kommen lässt oder wenn sie die zum Schweigen Gebrachten in Forschung und Lehre in die Erinnerung einbringt - und in der Schule. // Hier, im Gedächtnis des Leids, liegt jene "gefährliche Erinnerung", wie der Theologe Johann Baptist Metz es nannte und von der er oft so eindringlich gesprochen hat, die wir wieder brauchen, damit sie uns immer wieder beunruhigt und aus jeder Selbstgenügsamkeit aufrüttelt. Er, Metz, formulierte vor nun 40 Jahren für die Synode der deutschen Katholiken die folgenden bewegenden Sätze: "Die vergangenen Leiden zu vergessen und zu verdrängen, hieße uns der Sinnlosigkeit dieser Leiden widerspruchslos zu ergeben. Schließlich macht auch kein Glück der Enkel das Leid der Väter wieder gut, und kein sozialer Fortschritt versöhnt die Ungerechtigkeit, die den Toten widerfahren ist. Wenn wir uns zu lange der Sinnlosigkeit des Todes und der Gleichgültigkeit gegenüber den Toten unterwerfen, werden wir am Ende auch für die Lebenden nur noch banale Versprechen parat haben." // Erinnerung in diesem starken Sinne ist die Erinnerung daran, dass auch unsere Existenz sich dem Opfer anderer, vor uns Lebender verdankt, das nicht vergeblich gewesen sein soll und nicht vergeblich gewesen sein darf. Und dass wir in unserem Leben dazu aufgerufen sind, Leid nach Möglichkeit zu verhindern, Menschen, so es an uns liegt, nicht zu Opfern werden zu lassen. Das kann durch Unterlassen des Bösen geschehen oder durch Tun des Guten. // Etwas liegt mir zum Schluss noch am Herzen, es hat auch mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Manchmal frage ich mich, ob die Geschichte nicht dabei ist, über die Gegenwart und über die Zukunft zu siegen. Hat man noch vor nicht allzu langer Zeit anklagend von der" Geschichtslosigkeit" und "Geschichtsvergessenheit" der Gegenwart gesprochen, so scheint mir heute geradezu das Gegenteil zuzutreffen. Unaufhörlich, so sieht es aus, sind wir mit der Geschichte, mit Jubiläen, Gedenktagen, Erinnerungen, Denkmälern oder Denkmalplanungen konfrontiert. Wo ist nur die Zukunft hin? // Oft haben wir den Eindruck, die Zukunft, sie käme sozusagen von allein, und zwar mit rasender Geschwindigkeit, sie sei im Grunde das Werk einiger weniger Ingenieure, Softwarefirmen, Investoren und vielleicht auch noch von Politikern. Dazu kommt das Gefühl: Die Welt ist heute so komplex geworden, dass die Folgen vieler Entscheidungen nicht mehr abzusehen sind. Die gegenwärtigen Krisen tun ein Übriges, um uns ratlos zu machen und viele von uns zu lähmen. // Aber die Zukunft, sie kommt nicht von selbst, früher nicht und heute nicht. Wenn wir uns auch daraufhin einmal die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass - jenseits aller Zufälle und unbeabsichtigten Wechselwirkungen - das meiste bewusst von Menschen gemacht, von Menschen bewirkt worden ist - oder auch von Menschen verhindert. Wer die Hand in den Schoß legt und glaubt, die Zukunft würden schon andere für ihn gestalten, der macht sich selber schnell zum Opfer und wird sehr schnell auf eine ungute Verliererstraße geraten. // Alles, was wir heute so intensiv genießen, Frieden, Freiheit, unseren Wohlstand - was Menschen in so vielen Teilen der Welt so bitter fehlt - ist das mühsam genug erreichte Werk von Menschen. Und es ist zerbrechlich und endlich, wie alles Menschenwerk. Es muss verteidigt, erneuert, wo nötig, neu errungen werden. Es gibt kein Ende der Geschichte. // Wenn die Geschichte keinen Schluss kennt, dann gilt aber auch, dass es nie zu spät ist, gegenwärtiges Leid und Unglück zu wenden. Dann ist Hoffnung sinnvoll, dann kann uns Hoffnung zu entschiedenem Handeln motivieren. // Wir haben es zu einem großen Teil selber in der Hand, ob wir uns im Spiel dieser Welt als Gewinner oder als Verlierer beschreiben können. Wenn die Geschichte auch oft als Lehrmeisterin wenig brauchbar ist: Gute und ermutigende Beispiele, wie aus vermeintlichen Verlierern durch eigenen Mut und eigene Tatkraft, aber auch durch solidarisches Handeln, Gewinner werden können, die gibt es in Fülle. // Meine eigene Lebenserfahrung - und nun meldet sich doch der Zeitzeuge - sie lehrt mich, dass es nicht umsonst ist, sich stark zu machen für eine andere, bessere Zukunft, für eine Veränderung der Verhältnisse. Sicher, so etwas wie die Friedliche Revolution 1989 in Mittelosteuropa und der DDR - so etwas geschieht nicht alle Tage. Aber was wir dort erlebt haben, das bleibt ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Geschichte selbst in Situationen, die unabänderlich erscheinen, beeinflussbar und gestaltbar ist. // Wir haben es, zu einem Teil wenigstens, auch in der Hand, dass das Spiel dieser Welt weniger Verlierer und mehr Gewinner haben kann. Es liegt auch an uns, ob wir auf Kosten anderer siegen wollen oder ob wir dafür sorgen, dass möglichst viele zu Gewinnern werden. Es liegt auch an uns, dass Verlierer eine neue und gerechte Chance bekommen. Es gehört zu der Verantwortung, zu der unser Land sich in Wort und Tat bekennen muss und bekannt hat, dass Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, in welch mühsamen und kleinen Schritten auch immer, auch und gerade durch unseren Beitrag wachsen mögen. // Die Geschichte gibt uns kein unfehlbares Wissen darüber, was in einer gegebenen Situation richtig ist. Aber wir können aus der historischen Erfahrung ganz gewiss eine Überzeugung gewinnen: Wer sich für Freiheit und Menschenwürde eingesetzt hat, für das Recht und die Gerechtigkeit, für Anstand, für Menschlichkeit, der mag vielleicht eine Zeit lang auf der verlorenen Seite gewesen sein - auf der falschen war er nicht.
-
Joachim Gauck
Es sind dies bewegte Zeiten - auch für Sie, lieber Herr Schröder. In den vergangenen Wochen standen Sie im Mittelpunkt des medialen Interesses. Ihre aktuellen Äußerungen und Ihre Aktivitäten sind viel diskutiert worden. Daran möchte ich heute ausdrücklich nicht anknüpfen. Denn wir treffen uns hier zu Ehren eines Mannes, eines Bundeskanzlers, der im Amt unser Land entscheidend vorangebracht hat. Um dieses Verdienst soll es uns heute gehen. // Knapp zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Einheit in Freiheit wurden Sie, lieber Herr Schröder, zum Bundeskanzler gewählt. Die Welt schien nach dem Ende des Kalten Krieges, wiewohl nicht frei von Konflikten, so doch sicherer geworden zu sein. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts ereignete sich mit den Terroranschlägen auf die Zwillingstürme des World Trade Center nicht weniger als eine Zeitenwende in der internationalen Politik - mit denen große innen- wie außenpolitische Herausforderungen für Sie und Ihre Regierung einhergingen. // Viel ist über Ihren persönlichen Weg von Bexten und Talle über Göttingen und Hannover nach Bonn und schließlich nach Berlin geschrieben worden. Wichtig scheint mir, dass Sie in einer von materiellen Entbehrungen und sozialer Ausgrenzung geprägten Kindheit lernten, wie bedeutsam Zielstrebigkeit und Ehrgeiz sind. Auch wussten Sie schon früh, was Zusammenhalt bedeutet und wie wichtig die Unterstützung durch andere für jeden von uns ist. Für Sie war die größte Unterstützerin Ihre Mutter, deren unermüdlichen Einsatz für ihre Kinder, auch unter schwierigsten Bedingungen, Sie in bewegenden Worten öffentlich gewürdigt haben. // Mit Entschlossenheit und Disziplin haben Sie Ihren beruflichen Traum verwirklicht. Eigentlich war es nicht nur ein Traum, es waren zwei: In der Abendschule machten Sie das Abitur und studierten anschließend Jura, um als Rechtsanwalt zu arbeiten. Das ist an sich schon bemerkenswert. Das gilt übrigens auch für die politischen Schlüsse, die Sie aus Ihrem eigenen Weg zogen: Von "Dankbarkeit gegenüber einem Staat, der es mir doch ermöglicht hatte, den ersten Schritt nach oben zu tun" haben Sie später berichtet. Diese Dankbarkeit zeigte sich wohl auch in jenem gesunden Pragmatismus, mit dem Sie manch eigenartigen Formen der 68er begegneten. Sie anerkannten zwar das richtige Bestreben, drängende Fragen an die Elterngeneration zu richten und die Gesellschaft zu öffnen. Aber Sie wandten sich der mühevollen politischen Praxis zu und damit dem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern - nicht in der marxistischen Theorie, sondern in der konkreten Realität. // Danach gelang Ihnen auch noch, höchste politische Ämter zu erreichen - Sie wurden Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Ministerpräsident Niedersachsens, Vorsitzender Ihrer Partei und schließlich Bundeskanzler. Dieser unbedingte Wille zum Aufstieg hat mich beeindruckt. Damit sind Sie ein herausragendes Beispiel dafür, welche Aufstiegsgeschichten die Bundesrepublik zu erzählen hat."Bildungschancen sind stets Lebenschancen. [ ] Ich habe es selber gespürt." Diese eigene Erfahrung und der Antrieb, möglichst allen Kindern gute Bildungs- und Lebenschancen zu ermöglichen, wurden zum Movens auch Ihrer Arbeit als Bundeskanzler. Mancher hier im Saal wird dabei etwa an das 4 Milliarden Euro starke Investitionsprogramm des Bundes für verlässliche Ganztagsschulen denken, das Sie seinerzeit durchsetzten. // In Ihre Amtszeit als Bundeskanzler fallen zahlreiche Ereignisse, die man - wie auch immer man sie im Einzelnen bewertet - als zeitgeschichtliche Wegmarken bezeichnen muss. Nach Ihrem Wahlsieg 1998 schlossen Sie das erste rot-grüne Bündnis auf Bundesebene. Politisch betrachtet wurde die Republik bunter. // Ihr damaliges Bündnis ist vielfach beschrieben und charakterisiert worden, von den Medien wie von den Protagonisten selbst. Nicht nur ein Generationenwechsel war das, nach 16 Jahren Kanzlerschaft Helmut Kohls. Auch so etwas wie ein Neubeginn, ja ein Aufbruch, verband sich für viele Menschen mit der rot-grünen Bundesregierung. Als dritter Sozialdemokrat nach Willy Brandt und Helmut Schmidt wurden Sie Bundeskanzler, und erstmals überhaupt in der Bundesrepublik gelang es Ihnen, eine amtierende Bundesregierung abzulösen und eine vollständig neue Regierungsmehrheit anzuführen. // Nur wenige Monate nach der Wahl mussten Sie über eine der grundsätzlichsten Fragen entscheiden, die sich ein deutscher Regierungschef nur vorstellen konnte: ob deutsche Soldaten in einen Kampfeinsatz geschickt werden sollen, zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Gemeinsam mit dem damaligen Außenminister Joschka Fischer machten Sie deutlich, worum es bei diesem Einsatz ging: schweren Menschenrechtsverletzungen im zerfallenden Jugoslawien und damit mitten in Europa ein Ende zu setzen und, so haben Sie es beschrieben, "an der Schwelle zum 21. Jahrhundert den neuerlichen Brandherd auf dem Balkan nicht nur zu löschen, sondern die Region zu einem friedlichen Miteinander zu bringen". Der Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan - uns allen steht vor Augen, wie ernsthaft und verantwortungsvoll Sie und Ihre Regierung damals mit dieser Entscheidung rangen. // Ein weiterer Einschnitt in der politischen Geschichte der Bundesrepublik war zweifellos der Regierungsumzug nach Berlin im Sommer 1999. Als Kanzler waren Ihnen die Besonderheiten der deutsch-deutschen Geschichte ganz besonders präsent: Während der ersten beiden Regierungsjahre war das Kanzleramt provisorisch im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude untergebracht. Ihr Blick aus dem Fenster fiel damals noch auf den "Palast der Republik". Der Blick auf das Alte half Ihnen offenkundig dabei, Innovationen zu wagen: Ich denke zum Beispiel an das bis heute bestehende Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. // Als Bundeskanzler war Ihr Blick in die Vergangenheit wie in die Zukunft gerichtet. Sie brachten die lange überfällige Entschädigung für die ehemaligen NS-Zwangsarbeiter ebenso auf den Weg wie richtungsweisende Wirtschafts-, Sozial- und Rechtsreformen, etwa - damals heißumstritten - ein zeitgemäßeres Staatsbürgerschaftsrecht und die eingetragene Lebenspartnerschaft. Schon in Ihrer ersten Regierungserklärung am 10. November 1998 setzten Sie sich mit der Rolle Deutschlands auseinander: "Wir sind stolz auf dieses Land. Was ich hier formuliere, ist das Selbstbewusstsein einer erwachsenen Nation, die sich niemandem über-, aber auch niemandem unterlegen fühlen muss." // Diese veränderte Rolle der Bundesrepublik zeigte sich auch darin, dass Sie als erster deutscher Bundeskanzler zu den Feierlichkeiten anlässlich der Jahrestage der Landung der Alliierten in der Normandie, der Niederschlagung des Warschauer Aufstands und zur Erinnerung an das Kriegsende nach Moskau eingeladen wurden. // Sie selbst waren, wenn Sie sich entschlossen hatten, in Ihrem politischen Handeln konsequent. Und Sie scheuten auch Risiken nicht: Die Entscheidung über die deutsche Beteiligung am Afghanistan-Einsatz verbanden Sie im Bundestag mit der Vertrauensfrage, nachdem Sie den Vereinigten Staaten von Amerika Deutschlands" uneingeschränkte Solidarität" ausgesprochen hatten. Die Bereitschaft Deutschlands, im Bündnis mit seinen Partnern "Ja" zu wohlüberlegter außenpolitischer und, wenn nötig, militärischer Verantwortung zu sagen, verbindet sich ebenso mit Ihrer Kanzlerschaft wie Ihr entschlossenes "Nein" zu einer deutschen Beteiligung am Irakkrieg. // Auch innenpolitisch waren Sie bereit, unpopuläre Schritte zu gehen und die Folgen zu akzeptieren. Dazu gehören natürlich die Reformen der "Agenda 2010", für die Sie zunächst hart kritisiert wurden. Doch Sie haben mit Weitsicht dazu beigetragen, dass unser Land seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiedergewinnen und dann erhalten konnte. // Über die "Agenda 2010" sagten Sie rückblickend: "Wenn Sie eine solche umfassende Reform einleiten wollen, müssen Sie die notwendigen und schmerzhaften Entscheidungen jetzt treffen, während Sie die positiven Folgen dann drei Jahre später sehen. Dadurch entsteht eine Zeitlücke - und in diese Zeitlücke kann demokratisch legitimierte Politik fallen." // Der französische Politiker und Denker Talleyrand sagte, kein Abschied auf der Welt falle schwerer als jener von der Macht. Sie mussten nach einer vorgezogenen Wahl 2005 Abschied von der Macht nehmen. Leicht ist es Ihnen nicht gefallen, das haben Sie später selbst gesagt. Doch auch wenn die Macht verloren geht, so bleibt doch ein Stück Verantwortung für das Land - auch nach der Amtszeit. // Lieber Herr Schröder, Sie haben als Bundeskanzler der Weitsicht - und damit der Zukunft unseres Landes - den Vorzug gewährt, dafür gebührt Ihnen großer Respekt. So danke ich Ihnen für Ihre bleibenden Verdienste. // Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie Ihr Glas auf Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf. Auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohl!
-
Joachim Gauck
Es war mir in meinem Leben so wenig gesungen, Präsident zu werden, wie es Karl Carstens geschehen ist. Er kam nicht aus erlauchten Kreisen, sondern hat sich seinen Weg von unten an die Spitze einer freien Republik gebahnt. Und dass ich, der ich vom Osten her so oft sehnsüchtig ins Fernsehen geschaut habe auf das, was sich hier im deutschen Parlament der Freiheit abgespielt hat, an diesem Ort verschiedene Male sprechen kann und nun auch einen Bundespräsidenten würdigen kann, das ist ein besonderes Geschenk der Geschichte. Und es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. // Wir ehren heute einen Mann, dessen Dienst am Gemeinwesen wir als herausragend empfinden, dessen Einsatz zur Förderung des freiheitlich verfassten Staates vorbildlich war. Deshalb treffen wir uns hier in guter Laune und mit Zuversicht, weil die Erinnerung an eine solche Haltung und an ein solches Wirken uns selber stärken soll. Karl Carstens' pragmatischer Realismus, sein Pflichtbewusstsein und die überzeugende Repräsentanz der Demokratie und unseres Gemeinwesens, das kann uns bis heute Orientierung geben. Als Realist und Pragmatiker war er bekannt. In der Rückschau treten aber auch jene Elemente seines Denkens hervor, die hineinragen bis in unsere Zeit. // Deshalb bin ich der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr dankbar, dass sie zu dieser Gedenkstunde zum 100. Geburtstag von Karl Carstens eingeladen hat - ich bin dieser Einladung gern gefolgt. // Denn damit wird uns Gelegenheit gegeben, die Welt des Karl Carstens neu zu betrachten und seine Republik - unsere Republik! - geistig zu durchwandern. Ja, wandern. // Mit dem "Wander-Präsidenten" begeben wir uns also noch einmal zurück in jene Zeit. // Beim Wandern, das spürt man, kommt gelegentlich die Heiterkeit auf, die damals die Zeitgenossen bewegte. Das begann schon während seiner Antrittsrede, da hat er die deutsche Öffentlichkeit darüber informiert, er werde die Republik im Laufe seiner Amtszeit durchwandern, zu Fuß, etappenweise, von der Ostsee bis zu den Alpen. Natürlich gibt es Kritiker, wenn man ein solches Vorhaben ankündigt. // Und die haben dann gleich geschlossen: altbacken, irgendwie provinziell! Wandern: Wer macht das schon? Irgendwie traditionalistisch, dieser Bundespräsident. Und das nach den wilden Zeiten der 1968er Ära. // Dabei hatte Karl Carstens einen interessanten Plan. Einerseits konnte er eine Zeitströmung aufnehmen und sie zugleich auf eine zurückhaltende Weise ein wenig hinterfragen. Die Sorge um die Umwelt hatte damals besonders junge Leute ergriffen. Carstens teilte diese Sorge durchaus, wollte sich aber der generellen Wachstums- und Zivilisationskritik entgegenstellen. Es war natürlich auch das Milieu, aus dem heraus sehr forciert diese Themen angebracht wurden, von der damals sehr jungen grünen Bewegung. Das lag Carstens nicht, das müssen wir ja nicht verbergen. // Er machte sich dann auf seine Weise daran, die Naturschönheiten Deutschlands zu erkunden - zu Fuß. Das war eine ganz eigenartige, als Norddeutscher würde ich sagen, eine gediegene Einladung an das Bürgertum, ein bisschen genauer hinzuschauen, was unser Land eigentlich ausmacht. Damals gab es als Herausforderung das sogenannte "Waldsterben". Während der Wanderungen sah Carstens sich auch Demonstranten gegenüber, die darauf in besonderer Weise aufmerksam machten. Er konnte dann auf seine Weise Gespräche führen, beispielsweise über die Idee, bleifreies Benzin einzuführen. // "Unterwegs", so schrieb eine große Zeitung, "unterwegs ging den Spöttern die Luft aus". Der Bundespräsident war ja mit offenen Augen unterwegs. Und so begegnete er auf seinen Wanderungen nicht nur der Fichte und der Tanne, dem Bärwurz und dem Sonnentau, sondern er begegnete Menschen, und zwar sehr vielen Menschen. Anfangs waren es dutzende, die ihn begleiteten, später hunderte, schließlich tausende. Sie brachten gerne auch Proviant mit und Geschenke oder sangen ihm etwas vor. Das war dann so eine wunderbare Begegnungsmöglichkeit mit den Bürgern. Nach 60 Tagen und 1600 Kilometern war Karl Carstens und seiner Frau Veronica, die ihn oft begleitete, keine Sorge mehr fremd, die es in diesem Land gab. // Bei Amtsantritt hatte der Bremer Karl Carstens eher als norddeutsch-kühl gegolten, vielleicht auch als hanseatisch-streng. Aber nun zeigte sich seine Wärme, auch Herzlichkeit. Er konnte Nähe herstellen und Barrieren niederreißen. Er zeigte - wie auch sein Vorgänger Walter Scheel -, dass sich die Würde des Amtes durchaus mit Bürgernähe verträgt. Eine Kluft zwischen Repräsentanten und Repräsentierten, die muss es nicht geben, das wissen wir alle. Denn in der Demokratie ist jeder Bürger gleich. Und Autorität wird in ihr nur auf Zeit verliehen, durch Wahl. Und im Mittelpunkt, auch das wissen wir, steht immer der Souverän, steht unser Volk. Indem er diese Ansichten seinerseits beglaubigte, hat Karl Carstens ein Amtsverständnis demonstriert, dem sich Bundespräsidenten bis heute verpflichtet fühlen. Sich hinein versetzen in andere, das kann eben nicht jeder. Karl Carstens hat sich diese Qualität erarbeitet, und vielleicht darf er auch damit als ein Wanderer gelten - nicht zuletzt war er auch ein Wanderer zwischen den Welten. // Er bewegte sich zwischen der Privatwirtschaft und Wissenschaft hin und her, zwischen Ministerialbürokratie und Politik. Er war Anwalt und war Diplomat, Hochschullehrer und Parlamentarier, Staatssekretär und dann Bundestagspräsident. Er brachte Erfahrungen aus der einen Sphäre ein in die andere. Sein Werdegang ist ein frühes Beispiel für eine vielseitige Karriere mit bemerkenswertem Ausgang. // Karl Carstens darf auch als Rollenvorbild für den Aufstieg durch Bildung gelten. Und meine Damen und Herren, schauen Sie sich in unserer politischen Landschaft um. Sie werden dieses Modell in den verschiedenen Parteien immer wieder erblicken. Es wäre schlimm, wenn das in unserem Land in Zukunft nicht mehr möglich wäre. Wir arbeiten daran, dass das so bleibt. // Karl Carstens hat seinen Vater nie kennengelernt, er fiel im Ersten Weltkrieg, noch vor der Geburt des Sohnes. Die Mühen der Vaterlosigkeit und drohender sozialer Abstieg prägten Carstens' Jugend. Und doch trugen ihn Talent, Fleiß und Leistungsbereitschaft in eine Bildungslaufbahn, die ihn zur Professur und schließlich ins höchste Amt unseres Staates führte. // Carstens' Karriere begann, als die Bundesrepublik gegründet wurde. Sein steiler Aufstieg ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel dieser Republik. Er gehörte zu jener Generation, die sich mit den Irrungen und Lasten und vielfältiger Schuld während der NS-Diktatur auseinandersetzen musste. // Und er musste diese Lehren auch für sich selbst ziehen. Als er 1979 für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, nahmen ihm Teile der Öffentlichkeit diesen Lernprozess nicht ab. Sie sahen Carstens' Wahl gar als Gipfel der Verdrängungskunst. Denn er war Mitglied der NSDAP gewesen. Tatsächlich war seinerzeit Druck auf Carstens ausgeübt worden, dass er, um Rechtsanwalt zu werden, in die Partei eintreten müsse. Karl Carstens beugte sich. Und zwar, wie er später formulierte, wider die eigenen "besseren Überzeugungen". Er selbst sagte damals, dass er "verstrickt" gewesen sei. Er benutzte dieses Wort. Eine intensive, zumal öffentliche, Auseinandersetzung mit der objektiv geringen eigenen Verstrickung suchte Carstens nicht. // Als er für das Amt des Bundespräsidenten kandidierte, hatte die notwendige Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus inzwischen weite Teile der Bevölkerung erreicht. In diesen Jahren war die Erkenntnis gewachsen, wie viele Personen des öffentlichen Lebens tatsächlich verstrickt gewesen waren, auf die eine oder andere Weise. Es gab auch so etwas wie eine systemische Verstrickung, die vielfach ohne persönliche Schuld war. Aber sie existierte eben, und man war zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise bereit, darüber zu sprechen. // Aus heutiger Sicht illustrieren die damaligen Kontroversen, welch schmerzhafte Prozesse notwendig waren, um der Bundesrepublik trotz ihrer Vorgeschichte ein so ansehnliches Profil zu geben. Aus heutiger Sicht können und müssen wir sagen, dass manches damals leichter gewesen wäre, wenn mehr Betroffene früher Schuld auch als Schuld benannt und anerkannt hätten. Aber es zählt zu den großen Errungenschaften der Nachkriegsgeschichte, auf den Trümmern des Totalitarismus, auf tiefer Schuld und moralischem Versagen, ein neues Haus der Demokratie gebaut zu haben. Gewiss konnten nur wenige Repräsentanten der frühen Bundesrepublik auf eine Biographie ohne Verstrickung und ohne Widerspruch zurückblicken. Aber die meisten von denen, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung übernahmen und sich in den demokratischen Parteien engagierten, zogen aus der Erfahrung ihrer Generation einen wichtigen Schluss: dass nur unbedingtes Eintreten für die Demokratie und den Rechtsstaat Deutschland in die Zukunft führen konnte und dass die Würde des Menschen und die Grundrechte des Einzelnen Kern dieser Republik waren. Karl Carstens hat diese Erkenntnis glaubhaft und überzeugend vertreten. Dafür sind wir ihm dankbar. // Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn suchte er keineswegs den Weg in den öffentlichen Dienst. Nach der Befreiung wollte er staatsfern bleiben. Doch er besann sich früh, 1948, nach einem prägenden Erlebnis - einem Studienaufenthalt an der amerikanischen Yale-Universität. // Er traf dort auf den Geist der Freiheit und auf eine Bereitschaft zum Engagement für das Gemeinwohl, die ihn ansteckten und die er mit zurück nach Bremen brachte. Später habilitierte er sich mit einer Arbeit über die amerikanische Verfassung. Schließlich bedurfte es nur noch der Einladung seines Mentors, des Bremer Bürgermeisters Wilhelm Kaisen, einer der Gründungsfiguren der Bundesrepublik. Er hat sich als Sozialdemokrat übrigens schon frühzeitig für die Westintegration eingesetzt. Machen wir uns dieser Tage immer mal wieder bewusst, wie wichtig es für dieses Land ist, nicht von einem Weg abzuweichen, der so wichtig war für Deutschland, für das geteilte Deutschland wie für das wiedervereinigte. Aus diesem Grunde ist es mir an dieser Stelle eine große Freude, dass ich mit Dankbarkeit den Namen eines solchen wachen und wunderbaren Sozialdemokraten nennen kann. Dagegen hat die Adenauer-Stiftung sicher nichts einzuwenden. // Mit Hilfe von Wilhelm Kaisen fand sich nun also Karl Carstens im Staatsdienst wieder. Fortan und bis zu seinem Tod war er davon überzeugt, dass Deutschlands Platz an der Seite der freien Völker sein müsse. Die Pflege enger Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika stand für ihn "an erster Stelle aller außenpolitischen Überlegungen". Deutschland brauche Freunde und Verbündete, und die finde es im Westen im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft und der NATO. Denn wer verantwortlich Politik betreiben wolle, dürfe die Macht des großen Nachbarn im Osten nicht außer Acht lassen. Im westlichen Bündnis sah Carstens, so sagte er, die Grundlage für eine "kraftvolle, gesicherte, freiheitlich-demokratische Bundesrepublik". // Für Carstens, den schnell bis zum Staatssekretär aufsteigenden Diplomaten, war die große Aufgabe der Nachkriegszeit die Aussöhnung mit Frankreich. Und er hat dabei aktiv mitgewirkt. Er beschäftigte sich intensiv mit europäischen Fragen, als Wissenschaftler wie als Praktiker. // Nicht zuletzt seine Erfahrungen als Ständiger Vertreter der Bundesrepublik beim Europarat und seine Teilnahme an den Verhandlungen zu den Römischen Verträgen machten ihn zum Verfechter der Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Am Erfolg der Europäischen Integration hat er großen Anteil: Als die Verhandlungen über den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Oktober 1956 in eine schwere Krise gerieten, waren es Karl Carstens und sein französischer Partner Robert Marjolin, die ein Scheitern der Verhandlungen verhinderten. Der Kontinent, davon war Karl Carstens sein Leben lang überzeugt, müsse mehr sein als nur eine Freihandelszone, er müsse sich auch politisch einigen. // Aus heutiger Perspektive wissen wir besonders zu schätzen, wie Carstens die Westintegration als Bedingung der deutschen Einheit erkannte und betonte. Nach seiner Auffassung hätte die Bundesrepublik ohne Westbindung keine hinreichende Attraktivität auf die Bewohner der DDR ausüben können. Und ohne Westintegration, ohne europäische Integration hätte man nicht Frankreich, nicht Großbritannien und auch nicht die Vereinigten Staaten dem Ziel der Wiedervereinigung verpflichten können. Daraus ergaben sich für Carstens wie selbstverständlich die Prioritäten bundesdeutscher Politik: Freiheit - Frieden - Einheit, in dieser Reihenfolge. // Und so gehörte es für den Bundespräsidenten Carstens zu den unverzichtbaren Elementen eines jeden Staatsbesuches, die Gesprächspartner daran zu erinnern, dass die Bundesrepublik auf einen Zustand des Friedens in Europa hinwirkt, "in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt". Besuchern aus den entferntesten Gegenden der Welt - wie etwa dem Königspaar von Tonga - präsentierte er dieses Zitat aus dem "Brief zur Deutschen Einheit". // Der Logik der frühen Ostpolitik mochte er nicht folgen. Nachdem die Ostverträge dann aber abgeschlossen waren, hat er gleichwohl erkannt, dass Deutschland der Wiedervereinigung ohne eine Entspannung des Verhältnisses zu den Staaten des Warschauer Paktes nicht näher kommen würde. Aus heutiger Sicht war Karl Carstens ein Deutschland- und Außenpolitiker, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass ein Land entstand, in dem wir bis heute in Freiheit, in Frieden und in Wohlstand leben können. // Er sah sein Amt als Bundespräsident als parteiferne Instanz an, übte seine verfassungsrechtlichen Pflichten mit Bedacht aus und machte gleichzeitig deutlich, dass er sich seiner amtsspezifischen Autorität bewusst war. So ließ er den Bundeskanzler einmal vertraulich wissen, dass er die Entlassung eines Ministers nicht vornehmen werde, weil er sie für ungerechtfertigt hielt. // Die wichtigste innenpolitische Entscheidung seiner Präsidentschaft hatte er Anfang 1983 zu treffen, als es darum ging, den Bundestag vorzeitig aufzulösen und Neuwahlen anzuordnen. Bundeskanzler Kohl wollte - nach der Übernahme der Kanzlerschaft - seine Bundesregierung durch Bundestagswahlen grundsätzlich neu legitimieren lassen und hatte deshalb im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt - mit dem Ziel der Bundestagsauflösung. // Wie geplant, ging dann die Abstimmung verloren. // Es war nicht nur Carstens' wichtigste, es war - wie er selber sagte - seine "schwerste Entscheidung". Er beriet sich genau 21 Tage lang, so lange, wie es das Grundgesetz höchstens erlaubt. Er wusste, dass seine Entscheidung politisch und rechtlich umstritten sein würde, egal wie sie ausfiel. Er wollte sie als ordentlicher Professor des Staatsrechts vor seiner Zunft vertreten können. Und zugleich ahnte er, dass seine Entscheidung im Wege der Organklage beim Bundesverfassungsgericht angefochten werden würde, als erstes Verfahren dieser Art für einen Bundespräsidenten. // Damals, im Übergang von der SPD-FDP-Koalition zur Koalition aus Union und FDP, ging es um eine prinzipielle Frage: ob nämlich das Instrument der Vertrauensabstimmung, bewusst von der Regierungsmehrheit eingesetzt und doch in einer absehbaren Niederlage für den Bundeskanzler endend, zu einer Neuwahl führen könne und dürfe. Kritiker sahen darin eine "unechte" Vertrauensabstimmung, eine Trickserei, in der ein Vertrauensentzug nur vorgetäuscht werde. // So entstehe in der Praxis ein verfassungsfremdes Selbstauflösungsrecht des Parlaments. // Karl Carstens entschied sich für die Auflösung des Bundestages. In seiner Begründung sagte er, er habe nicht feststellen können, "aus welchen Gründen der einzelne Abgeordnete dem Bundeskanzler die Zustimmung versagt" habe. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass die vom Grundgesetz gewollte und politisch zu erstrebende stabile Regierung ohne Neuwahlen nicht mehr zu erreichen sei. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte später Carstens' Rechtsauffassung. Diese Bestätigung war für ihn essentiell, bekannte er doch später, er wäre zurückgetreten, hätte das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung nicht bestätigt. Diese Begebenheit ist bis heute bedeutsam, weil sie die Bedingungen von Misstrauensvoten und Neuwahlen zu klären half. Karl Carstens` umsichtiges Handeln im Sinne der Verfassung trug dazu bei, die Stabilität und die Regierungsfähigkeit des Landes zu sichern, zwei Prinzipien, die in der Hierarchie seiner politischen Wertmaßstäbe ganz weit oben standen. // Karl Carstens wurde auch deshalb zum respektierten Bundespräsidenten, weil er den scharfzüngigen Parteipolitiker, der er gewesen war, hinter sich ließ. Er nutzte sein Amt, um zu integrieren. Im Laufe seiner Amtszeit überzeugte er viele, die seine Wahl einst mit Skepsis betrachtet hatten. Respekt und Zuneigung aus allen Schichten der Bevölkerung kamen ihm entgegen. Daran hatte auch seine Gattin Veronica Carstens großen Anteil. Ich erinnere heute gerne an Sie. Während seiner Präsidentschaft arbeitete sie weiter als Ärztin und nahm dabei viele Sorgen und Nöte der Menschen auf. Gemeinsam gründeten sie die Karl-und-Veronica-Carstens-Stiftung. // Auch als Schirmherrin der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft erwarb sich Veronica Carstens große Verdienste. Wir dürfen uns heute auch vor ihr verneigen. // Und noch eines wollen wir nicht vergessen: Karl Carstens schöpfte aus dem christlichen Glauben und gab seine Kraft für die Idee des Gemeinwohls. Und beides hängt miteinander zusammen - so jedenfalls sehe ich das. // Die Quintessenz seines Denkens hinterließ er wenige Jahre vor seinem Tod in einer Rede in Dresden: "Wer frei ist, trägt Verantwortung, wer Rechte hat, der hat auch Pflichten, wer Ansprüche stellt, vor allem Ansprüche an den Staat, muss auch bereit sein, Leistung zu erbringen." Hinter diesen Sätzen können wir uns auch heute noch versammeln. // Verneigen wir uns also vor der Leistung eines deutschen Demokraten, und halten wir sein Andenken durch unsere Haltung und durch unsere Handlungen als Staatsbürger in Ehren.
-
Joachim Gauck
Gestern war ich in Bergen-Belsen. Ich musste daran denken, als ich die Bilder von Mauthausen sah. Heute darf ich mit Ihnen die österreichische Freiheit und Befreiung feiern. Ich bin tief bewegt und dankbar, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Nicht an irgendeinem Tag und zu irgendeinem Anlass, sondern gerade an jenem Tag, an dem Österreich vor genau 70 Jahren die Grundlagen für seine demokratische Nachkriegsordnung legte. // Noch tobten damals Kämpfe hier, aber auch um Breslau und Berlin. Noch befanden sich große Teile Österreichs in der Hand der Wehrmacht. Noch herrschte vielerorts der Terror der Nationalsozialisten: Zivilisten wurden erhängt oder erschossen, weil sie weiße Fahnen gehisst hatten. Soldaten wurden zum Tode verurteilt, weil sie sich von ihren Truppenteilen entfernt hatten. Doch die Hauptstadt Wien befand sich bereits in den Händen der Roten Armee. Und noch bevor die Wehrmacht kapitulierte, erklärte eine neue österreichische Regierung den gewaltsamen Anschluss an Deutschland 1938 für null und nichtig und proklamierte die Wiederherstellung der demokratischen Republik Österreich. Voller Erleichterung tanzten die Wiener zwischen den Trümmern ihrer Stadt zum Donauwalzer. // Die Bürger der Republik Österreich und die Bürger der Bundesrepublik Deutschland wissen sehr genau, warum wir das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft als Befreiung würdigen. Schrecklich allein die Vorstellung, die Alliierten hätten uns nicht befreit und unsere Vorgängergeneration hätte uns ein Europa unter dem Hakenkreuz hinterlassen. // Heute, nach Jahrzehnten demokratischer und ökonomischer Konsolidierung, leben Österreicher und Deutsche in einem spannungsfreien und freundschaftlichen Verhältnis - von Fußballländerspielen einmal abgesehen. Wir sind einander willkommen - als Köche und Kellner, als Fachärzte, als Wissenschaftler und Theaterleute. Geschäftsleute und Touristen überqueren millionenfach die Grenze in beide Richtungen. Viele unserer Unternehmen sind miteinander verflochten, und unsere Länder sind füreinander ein wichtiger Markt. // Zu Recht ist es oftmals betont worden: Österreicher und Deutsche sind sich besonders vertraut - allein schon wegen der Sprache. Das Publikum fragt kaum mehr, ob ein Schriftsteller, Komponist oder Schauspieler und Sänger in Deutschland oder Österreich geboren wurde und welche Staatsbürgerschaft er besitzt. // Unsere Völker verbindet zudem eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte: dazu gehört das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber natürlich auch blutiger Krieg, um Schlesien etwa, in der Vergangenheit, ebenso wie der 1815 gemeinsam ins Leben gerufene Deutsche Bund. Und selbst in der Zeit der Nationalstaatsbildung fühlten wir uns einander so nahe, dass die Debatte über einen gemeinsamen Staat lange Jahre auf der politischen Agenda stand. // Wir wissen, wie die Geschichte ausging. 1871 entstand das Deutsche Reich - ohne Österreich. Die staatliche Vereinigung Deutschlands und Österreichs war auch nach dem Ersten Weltkrieg keine Option, die Siegermächte hatten es so verfügt. Und als der Zusammenschluss dann 1938 als Anschluss Realität wurde, verspielte er im selben Moment jede Zukunftschance. Auch wenn Zehntausende auf den Straßen jubelten, als Adolf Hitler Österreich 1938 anschloss ans Deutsche Reich, so gab es zugleich die vielen anderen Österreicher, die in der nationalsozialistischen Herrschaft von Anfang an nichts als ein menschenverachtendes System der Unterdrückung sahen. Das, Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, ist eine Traditionslinie, auf die sich das moderne freiheitliche Österreich stolz berufen kann. Für die Menschen, die in dieser Tradition standen, war die Einheit mit Deutschland unter dem Vorzeichen der Diktatur eben keineswegs erstrebenswert, sondern erschreckend und bestürzend gewesen. // Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehen Deutschland und Österreich getrennte Wege - zunächst in kritischem Respekt, dann in wachsender freundschaftlicher Geneigtheit. Beide Staaten sind im Rückblick gut mit dieser Lösung gefahren. Mit dem Staatsvertrag von 1955, einem Meilenstein der zweiten Republik, wurde Österreich souverän und frei. Das ist nun schon 60 Jahre her. Längst bekennen sich die Österreicher ganz selbstverständlich zu ihrer Identität, voller Stolz auf dieses Land mit seiner wunderschönen Landschaft, seiner tiefverwurzelten Kultur, seiner politischen Stabilität und seinem sozialen Frieden. // In den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen Österreich und Deutschland vielfach vor ähnlichen Herausforderungen. Zunächst strebten beide nach dem Ende der Besatzung und nach der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität, was im Falle Deutschlands erheblich länger dauerte als im Falle Österreichs. Beide Länder hatten gewaltige Leistungen zu erbringen, um die vielen Flüchtlinge und Vertriebenen zu integrieren. Auch in Österreich standen zunächst der Wiederaufbau des Landes und die Mehrung des Wohlstands im Vordergrund. Dabei flüchteten viele Österreicher ebenso wie viele Westdeutsche vor den langen Schatten der Vergangenheit ins große Schweigen oder auch in die Traumwelt von Heimatfilmen oder Schlagermusik. Es hat mich sehr bewegt, Herr Bundespräsident, wie Sie diese Zeit und die Position innerhalb der Bevölkerung hier gerade beschrieben haben. // Der Umgang mit der eigenen Vergangenheit, das musste erst erlernt werden, von Deutschen wie von Österreichern. Sie, Herr Bundespräsident, gehörten 1962 zu den ersten, die in Österreich die fortdauernde Weitergabe von antisemitischem oder neonazistischem Gedankengut unter dem Dach einer Hochschule anprangerten. In den 1980er Jahren drangen die Dispute aus der Alpenrepublik bis ins europäische Ausland und bis nach Amerika. Ich weiß zu schätzen, welche große Bedeutung den Worten von Franz Vranitzky zukam, der 1991 als erster Bundeskanzler im Nationalrat aussprach, was lange - für einige viel zu lange - tabuisiert worden war: "Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen. Und so, wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen, bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten." // Deutschland hat nach seinen eigenen Erfahrungen im Umgang mit nationalsozialistischer, später auch mit kommunistischer Vergangenheit ähnliche Überzeugungen gewonnen wie Österreich: Wenn wir uns offen und unvoreingenommen der Vergangenheit nähern, kann Wissen an die Stelle des Schweigens treten. Wahrheit hilft und Wahrheit befreit. Wir achten die Erfahrungen eines jeden Einzelnen. Gewiss: Wir sind nationale Narrative gewohnt. Aber wir können durchaus die eigenen Sichtweisen um die Sichtweisen der Anderen erweitern, und wir können unsere bisherigen Sichtweisen, wo es erforderlich ist, verändern: Das beste Korrektiv gegenüber einem Denken, das sich primär am Nationalen orientiert, ist die Orientierung an universellen Werten, an den Menschenrechten und an der Menschenwürde. // Lassen Sie mich noch einen Blick auf die letzten Jahrzehnte werfen. In einem beispiellosen Einigungsprozess ist es gelungen, die Staaten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg verfeindet und misstrauisch gegenüber standen, auf der Grundlage der Prinzipien von Frieden, Freiheit und Menschenrechten zusammenzuführen. Es war ein Einigungsprozess, der zunächst im Westen des Kontinents, Jahrzehnte später auch in der Mitte und im Osten stattfand. Den Europäern ist es fast überall auf unserem Kontinent gelungen, den Dialog an die Stelle der Feindschaft, und das Miteinander der Verschiedenen an die Stelle eines Wettkampfs um Vorherrschaft und Macht zu setzen. Europa ist damit zum Modell für viele demokratische und freiheitsliebende Menschen auf der ganzen Welt geworden. // An dieser Stelle liegt es nahe, einen weiteren Jahrestag ins Gedächtnis zu rufen: Vor fast genau zwanzig Jahren, am 1. Januar 1995, wurde Österreich Mitglied der Europäischen Union. Sich militärisch zur Neutralität verpflichtend, ist Österreich politisch doch immer ein Teil jener Völkerfamilie gewesen, die sich der Freiheit des Einzelnen und des Rechts auf nationale Selbstbestimmung verschrieben hat. Gerade Österreich, das kommunistischen Ländern Nachbar war, wurde ein wichtiger Ort der Sehnsucht und der Zuflucht für Verfolgte aus Mittel- und Osteuropa. // Die besondere Anteilnahme der Österreicher am Schicksal der Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs verdient großen Respekt. Während des Aufstands 1956 standen sie an der Seite der freiheitsliebenden Ungarn. 1968 hofften und bangten sie mit den Tschechen und Slowaken während des Prager Frühlings. Flüchtlingen aus beiden Ländern begegneten sie mit viel Sympathie und Hilfsbereitschaft. Und im Frühsommer 1989 war Österreich gerne bereit, tausenden von DDR-Bürgern ein erstes Obdach zu bieten, als sich die Chance für die Flucht dieser Menschen bot, weil Ungarn schon den Schießbefehl aufgehoben und die Grenzen partiell geöffnet hatte. Das werden wir nicht vergessen und dafür bleiben wir dankbar. // Nachbarschaftliche und kulturelle Bande konnten erneuert werden, als Europa nach 1989 wieder eins wurde und Österreich den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellte. Die Wirtschaft profitierte von der Einigung - und mit ihr die Menschen. Und doch haben sich die Hoffnungen auf eine immer engere Zusammenarbeit nicht überall erfüllt. In einigen Ländern Europas, auch innerhalb der Europäischen Union, sehen wir Gefahren für Rechtsstaat und Pluralismus, in anderen das Anwachsen populistischer und nationaler bis nationalistischer Strömungen und Parteien. Sogar ein so großer und für uns alle so wichtiger Partner wie Großbritannien hat Schwierigkeiten, seine Mitgliedschaft in der EU dauerhaft zu bejahen. Dazu kommt noch die Gefahr, die islamistische Terrororganisationen innerhalb Europas darstellen. Angesichts dieser Herausforderungen gewinnt die gemeinsame Verteidigung und Festigung von Einheit, Freiheit und Demokratie in Europa eine neue, eine große Bedeutung. // Deshalb erscheint mir ein abgestimmtes, ja gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union in der Außenpolitik besonders bedeutsam zu sein. Wenn keine Garantie mehr besteht, dass überall in Europa das Völkerrecht geachtet wird, dann haben die Mitglieder der Europäischen Union neu über ihre gemeinsame Sicherheit nachzudenken. // Unsere beiden Staaten haben je eigene Erfahrungen gemacht mit den Möglichkeiten und den Grenzen der Politik in den Zeiten des Kalten Krieges: Konkurrenz und Konfrontation zwischen den beiden Machtblöcken bargen immer auch die Gefahr eines "heißen" Krieges. Trotz mancher Enttäuschungen setzen wir deshalb heute auf Deeskalation und Gespräch. // Zugleich wissen wir: Es war 1975 die Schlussakte des Helsinki-Prozesses und das Bekenntnis zu unveräußerlichen Menschenrechten und Grundfreiheiten, das der mitteleuropäischen Freiheitsbewegung auch Inspiration und Ermutigung bot. Es war der erklärte Wille der Menschen dort, unabhängig und selbstbestimmt, in Freiheit und Demokratie zu leben. Was vor einem Vierteljahrhundert bei Polen, bei Ungarn und Tschechen unsere ungeteilte Unterstützung fand, kann uns deshalb heute in der Ukraine nicht gleichgültig lassen. // Heute wie damals besteht Europa auf dem Respekt vor der Souveränität und territorialen Integrität jeden Landes und dessen Recht, seine Partner frei wählen zu dürfen. Heute wie damals weiß Europa, dass nichts den Wohlstand und das friedliche Zusammenleben besser sichert als die Menschen- und Bürgerrechte in einem funktionierenden Rechtsstaat. // Ich freue mich, dass ich an diesem Tag bei Ihnen sein kann. Und ich freue mich vor allem deshalb, weil unsere beiden voneinander getrennten Staaten doch noch mehr verbindet als eine gemeinsame Sprache. Es ist unser gemeinsames Wertefundament und es sind gemeinsame Ideale. Sie verbinden unsere Länder als gleichberechtigte Partner in der großen Familie der Europäischen Union. Und noch etwas verbindet uns: Österreich und Deutschland haben heute die gemeinsame Verantwortung, die Ordnung und die Werte auf denen sie beruht, in der Zukunft zu sichern. Es ist der Geist der europäischen Zusammenarbeit, der unsere Länder auch künftig vereinen wird. Der 70. Jahrestag der Wiedererrichtung der demokratischen Republik Österreich, zu dem ich von Herzen gratuliere, ist ein guter Anlass, sich darüber zu freuen und gemeinsam "Ja" zu sagen zu dieser Verantwortung.
-
Joachim Gauck
Herr Präsident des Deutschen Bundestages! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem In- und Ausland! // Zunächst Ihnen, Herr Präsident, meinen allerherzlichen Dank für die unnachahmliche Führung dieser Sitzung und für das leuchtende Beispiel in unser Land hinein, dass Politik Freude machen kann. Herr Bundesratspräsident, Sie haben Worte gefunden, die bei mir und sicher auch bei Herrn Bundespräsidenten Wulff ein tiefes und nachhaltiges Echo hinterlassen haben. Ich danke Ihnen. // Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie soll es denn nun aussehen, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel einmal sagen sollen "unser Land"? Geht die Vereinzelung in diesem Land weiter? Geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf? Verschlingt uns die Globalisierung? Werden Menschen sich als Verlierer fühlen, wenn sie an den Rand der Gesellschaft geraten? Schaffen ethnische oder religiöse Minderheiten in gewollter oder beklagter Isolation Gegenkulturen? Hat die europäische Idee Bestand? Droht im Nahen Osten ein neuer Krieg? Kann ein verbrecherischer Fanatismus in Deutschland wie in anderen Teilen der Welt weiter friedliche Menschen bedrohen, einschüchtern und ermorden? // Jeder Tag, jede Begegnung mit den Medien bringt eine Fülle neuer Ängste und Sorgen hervor. Manche ersinnen dann Fluchtwege, misstrauen der Zukunft, fürchten die Gegenwart. Viele fragen sich: Was ist das eigentlich für ein Leben, was ist das für eine Freiheit? Mein Lebensthema "Freiheit" ist dann für sie keine Verheißung, kein Versprechen, sondern nur Verunsicherung. Ich verstehe diese Reaktion, doch ich will ihr keinen Vorschub leisten. Ängste - so habe ich es gelernt in einem langen Leben - vermindern unseren Mut wie unser Selbstvertrauen, und manchmal so entscheidend, dass wir beides ganz und gar verlieren können, bis wir gar Feigheit für Tugend halten und Flucht für eine legitime Haltung im politischen Raum. // Stattdessen - da ich das nicht will - will ich meine Erinnerung als Kraft und Kraftquelle nutzen, mich und uns zu lehren und zu motivieren. Ich wünsche mir also eine lebendige Erinnerung auch an das, was in unserem Land nach all den Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur und nach den Gräueln des Krieges gelungen ist. In Deutschlands Westen trug es, dieses Gelungene, als Erstes den Namen "Wirtschaftswunder". Deutschland kam wieder auf die Beine. Die Vertriebenen, gar die Ausgebombten erhielten Wohnraum. Nach Jahren der Entbehrung nahm der Durchschnittsbürger teil am wachsenden Wohlstand, freilich nicht jeder im selben Maße. // Allerdings sind für mich die Autos, die Kühlschränke und all der neue Glanz einer neuen Prosperität nicht das Wunderbare jenes Jahrzehnts. Ich empfinde mein Land vor allem als ein Land des "Demokratiewunders". Anders als es die Alliierten damals nach dem Kriege fürchteten, wurde der Revanchismus im Nachkriegsdeutschland nie mehrheitsfähig. Es gab schon ein Nachwirken nationalsozialistischer Gedanken, aber daraus wurde keine wirklich gestaltende Kraft. Es entstand stattdessen eine stabile demokratische Ordnung. Deutschland West wurde Teil der freien westlichen Welt. // Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in dieser Zeit blieb allerdings defizitär. Die Verdrängung eigener Schuld, die fehlende Empathie mit den Opfern des Naziregimes prägten den damaligen Zeitgeist. Erst die 68er-Generation hat das nachhaltig geändert. Damals war meine Generation konfrontiert mit dem tiefschwarzen Loch der deutschen Geschichte, als die Generation unserer Eltern sich mit Hybris, Mord und Krieg gegen unsere Nachbarn im Inneren wie im Äußeren vergingen. Es war und blieb das Verdienst dieser Generation, der 68er: Es war ein mühsam errungener Segen, sich neu, anders und tiefer erinnern zu können. Trotz aller Irrwege, die sich mit dem Aufbegehren der 68er auch verbunden haben, hat sie die historische Schuld ins kollektive Bewusstsein gerückt. // Diese auf Fakten basierende und an Werten orientierte Aufarbeitung der Vergangenheit wurde nicht nur richtungsweisend für uns nach 1989 in Ostdeutschland. Sie wird auch als beispielhaft von vielen Gesellschaften empfunden, die ein totalitäres oder despotisches Joch abgeschüttelt haben und nicht wissen, wie sie mit der Last der Vergangenheit umgehen sollen. // Das entschlossene Ja der Westdeutschen zu Europa ist ein weiteres kostbares Gut der deutschen Nachkriegsgeschichte, ein Erinnerungsgut, das uns wichtig bleiben sollte. Konrad Adenauer, Kanzler des Landes, das eben noch geprägt und dann ruiniert war vom Nationalismus, wird zu einem der Gründungsväter einer zukunftsgerichteten europäischen Integration. Dankbarkeit und Freude! // So wie später - 1989 - dieser nächste Schatz in unserem Erinnerungsgut. Da waren die Ostdeutschen zu einer friedlichen Revolution imstande, zu einer friedlichen Freiheitsrevolution. Wir wurden das Volk, und wir wurden ein Volk. Und nie vergessen: Vor dem Fall der Mauer mussten sich die vielen ermächtigen. Erst wenn die Menschen aufstehen und sagen: "Wir sind das Volk", werden sie sagen können: "Wir sind ein Volk", werden die Mauern fallen. // Damals wurde auf ganz unblutige Weise auch der jahrzehntelange Ost-West-Gegensatz aus den Zeiten des Kalten Krieges gelöscht, und die aus ihr erwachsende Kriegsgefahr wurde besiegt und beseitigt. // Der Sinn dessen, dass ich so spreche, ist, dass ich nicht nur über die Schattenseiten, über Schuld und Versagen sprechen möchte. Auch jener Teil unserer Geschichte darf nicht vergessen sein, der die Neugründung einer politischen Kultur der Freiheit, die gelebte Verantwortung, die Friedensfähigkeit und die Solidarität unseres Volkes umfasst. Das ist kein Paradigmenwechsel in der Erinnerungskultur. Das ist eine Paradigmenergänzung. Sie soll uns ermutigen: Das, was mehrfach in der Vergangenheit gelungen ist, all die Herausforderungen der Zeit anzunehmen und sie nach besten Kräften - wenn auch nicht gleich ideal - zu lösen, das ist eine große Ermutigung auch für uns in der Zukunft. // Wie soll es nun also aussehen, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel "unser Land" sagen? Es soll "unser Land" sein, weil "unser Land" soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und Aufstiegschancen verbindet. Der Weg dazu ist nicht der einer paternalistischen Fürsorgepolitik, sondern der eines Sozialstaates, der vorsorgt und ermächtigt. Wir dürfen nicht dulden, dass Kinder ihre Talente nicht entfalten können, weil keine Chancengleichheit existiert. Wir dürfen nicht dulden, dass Menschen den Eindruck haben, Leistung lohne sich für sie nicht mehr und der Aufstieg sei ihnen selbst dann verwehrt, wenn sie sich nach Kräften bemühen. Wir dürfen nicht dulden, dass Menschen den Eindruck haben, sie seien nicht Teil unserer Gesellschaft, weil sie arm oder alt oder behindert sind. // Freiheit ist eine notwendige Bedingung von Gerechtigkeit. Denn was Gerechtigkeit - auch soziale Gerechtigkeit - bedeutet und was wir tun müssen, um ihr näherzukommen, lässt sich nicht paternalistisch anordnen, sondern nur in intensiver demokratischer Diskussion und Debatte klären. Umgekehrt ist das Bemühen um Gerechtigkeit unerlässlich für die Bewahrung der Freiheit. Wenn die Zahl der Menschen wächst, die den Eindruck haben, ihr Staat meine es mit dem Bekenntnis zu einer gerechten Ordnung in der Gesellschaft nicht ernst, sinkt das Vertrauen in die Demokratie. "Unser Land" muss also ein Land sein, das beides verbindet: Freiheit als Bedingung für Gerechtigkeit - und Gerechtigkeit als Bedingung dafür, Freiheit und Selbstverwirklichung erlebbar zu machen. // In "unserem Land" sollen auch alle zu Hause sein können, die hier leben. Wir leben inzwischen in einem Staat, in dem neben die ganz selbstverständliche deutschsprachige und christliche Tradition Religionen wie der Islam getreten sind, auch andere Sprachen, andere Traditionen und Kulturen, in einem Staat, der sich immer weniger durch nationale Zugehörigkeit seiner Bürger definieren lässt, sondern durch ihre Zugehörigkeit zu einer politischen und ethischen Wertegemeinschaft, in dem nicht ausschließlich die über lange Zeit entstandene Schicksalsgemeinschaft das Gemeinwesen bestimmt, sondern zunehmend das Streben der Unterschiedlichen nach dem Gemeinsamen: diesem unseren Staat in Europa. // Und wir finden dieses Gemeinsame in diesem unseren Staat in Europa, in dem wir in Freiheit, Frieden und in Solidarität miteinander leben wollen. // Wir wären allerdings schlecht beraten, wenn wir aus Ignoranz oder falsch verstandener Korrektheit vor realen Problemen die Augen verschließen würden. Hierauf hat bereits Bundespräsident Johannes Rau in seiner Berliner Rede vor zwölf Jahren eindrücklich und deutlich hingewiesen. Aber in Fragen des Zusammenlebens dürfen wir uns eben nicht letztlich von Ängsten, Ressentiments und negativen Projektionen leiten lassen. Für eine einladende, offene Gesellschaft hat Bundespräsident Christian Wulff in seiner Amtszeit nachhaltige Impulse gegeben. Herr Bundespräsident Wulff, dieses - Ihr - Anliegen wird auch mir beständig am Herzen liegen. // Unsere Verfassung, meine Damen und Herren, spricht allen Menschen dieselbe Würde zu, ungeachtet dessen, woher sie kommen, woran sie glauben oder welche Sprache sie sprechen. Sie tut dies nicht als Belohnung für gelungene Integration, sie versagt dies aber auch nicht als Sanktion für verweigerte Integration. Unsere Verfassung wie unser Menschsein tragen uns auf, im Anderen geschwisterlich uns selbst zu sehen: begabt und berechtigt zur Teilhabe wie wir. // Der Philosoph Hans-Georg Gadamer war der Ansicht, nach den Erschütterungen der Geschichte erwarte speziell uns in Europa eine "wahre Schule" des Miteinanders auf engstem Raum. "Mit dem Anderen leben, als der Andere des Anderen leben." Darin sah er die ethische und politische Aufgabe Europas. Dieses Ja zu Europa gilt es nun ebenfalls zu bewahren. Gerade in Krisenzeiten ist die Neigung, sich auf die Ebene des Nationalstaats zu flüchten, besonders ausgeprägt. Das europäische Miteinander ist aber ohne den Lebensatem der Solidarität nicht gestaltbar. // Gerade in der Krise heißt es deshalb: Wir wollen mehr Europa wagen. // Mit Freude sehe ich auch, dass die Mehrheit der Deutschen diesem europäischen Gedanken wieder und weiter Zukunft gibt. // Europa war für meine Generation Verheißung - aufbauend auf abendländischen Traditionen, dem antiken Erbe einer gemeinsamen Rechtsordnung, dem christlichen und jüdischen Erbe. Für meine Enkel ist Europa längst aktuelle Lebenswirklichkeit mit grenzüberschreitender Freiheit und den Chancen und Sorgen einer offenen Gesellschaft. Nicht nur für meine Enkel ist diese Lebenswirklichkeit ein wunderbarer Gewinn. // Wie kann es noch aussehen, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel "unser Land" sagen sollen? Nicht nur bei uns, sondern auch in Europa und darüber hinaus ist die repräsentative Demokratie das einzig geeignete System, Gruppeninteressen und Gemeinwohlinteressen auszugleichen. // Das Besondere dieses Systems ist nicht seine Vollkommenheit, sondern dass es sich um ein lernfähiges System handelt. // Neben den Parteien und anderen demokratischen Institutionen existiert aber eine zweite Stütze unserer Demokratie: die aktive Bürgergesellschaft. Bürgerinitiativen, Ad-hoc-Bewegungen, auch Teile der digitalen Netzgemeinde ergänzen mit ihrem Engagement, aber auch mit ihrem Protest die parlamentarische Demokratie und gleichen Mängel aus. Und: Anders als die Demokratie von Weimar verfügt unser Land über genügend Demokraten, die dem Ungeist von Fanatikern, Terroristen und Mordgesellen wehren. Sie alle bezeugen - aus unterschiedlichen politischen oder religiösen Gründen: Wir lassen uns unsere Demokratie nicht wegnehmen, wir stehen zu diesem Land. // Wir stehen zu diesem Land, nicht weil es so vollkommen ist, sondern weil wir nie zuvor ein besseres gesehen haben. // Speziell zu den rechtsextremen Verächtern unserer Demokratie sagen wir mit aller Deutlichkeit: Euer Hass ist unser Ansporn. Wir lassen unser Land nicht im Stich. // Wir schenken Euch auch nicht unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demokratie wird leben. // Die Extremisten anderer politischer Richtungen werden unserer Entschlossenheit in gleicher Weise begegnen. Und auch denjenigen, die unter dem Deckmantel der Religion Fanatismus und Terror ins Land tragen und die hinter die europäische Aufklärung zurückfallen, werden wir Einhalt gebieten. Ihnen sagen wir: Die Völker ziehen in die Richtung der Freiheit. Ihr werdet den Zug vielleicht behindern, aber endgültig aufhalten könnt ihr ihn nicht. // Mir macht allerdings auch die Distanz vieler Bürgerinnen und Bürger zu den demokratischen Institutionen Angst: die geringe Wahlbeteiligung, auch die Geringschätzung oder gar Verachtung von politischem Engagement, von Politik und Politikern. "Was?", so hören wir es oft im privaten Raum, "Du gehst zur Sitzung eines Ortsvereins?" "Wie bitte, Du bist aktiv in einer Gewerkschaft?" Manche finden das dann "uncool". Ich frage mich manchmal: Wo wäre eigentlich unsere Gesellschaft ohne derlei Aktivitäten? // Wir alle haben nichts von dieser Distanz zwischen Regierenden und Regierten. Meine Bitte an beide, an Regierende wie Regierte, ist: Findet Euch nicht ab mit dieser zunehmenden Distanz. // Für die politisch Handelnden heißt das: Redet offen und klar, dann kann verloren gegangenes Vertrauen wiedergewonnen werden. // Den Regierten, unseren Bürgern, muten wir zu: Ihr seid nicht nur Konsumenten. Ihr seid Bürger, das heißt Gestalter, Mitgestalter. Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der vergibt eine der schönsten und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben. // Zum Schluss erlaube ich mir, Sie alle um ein Geschenk zu bitten: um Vertrauen. Zuletzt bitte ich Sie um Vertrauen in meine Person. Davor aber bitte ich Sie um Vertrauen zu denen, die in unserem Land Verantwortung tragen, wie ich diese um Vertrauen zu all den Bewohnern dieses wiedervereinigten und erwachsen gewordenen Landes bitte. Und davor wiederum bitte ich Sie alle, mutig und immer wieder damit zu beginnen, Vertrauen in sich selbst zu setzen. Nach einem Wort Gandhis kann nur ein Mensch mit Selbstvertrauen Fortschritte machen und Erfolge haben. Dies gilt für einen Menschen wie für ein Land, so Gandhi. // Ob wir den Kindern und Enkeln dieses Landes Geld oder Gut vererben werden, das wissen wir nicht. Aber dass es möglich ist, nicht den Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen, davon haben wir nicht nur geträumt, sondern das haben wir gelebt und gezeigt. Gott und den Menschen sei Dank: Dieses Erbe dürfen sie erwarten.
-
Joachim Gauck
Heute vor 75 Jahren begann hier auf der Westerplatte der Zweite Weltkrieg. Während des Krieges standen mehr als 110 Millionen Menschen unter Waffen, fast 60 Millionen kamen um. Mehr als 60 Staaten waren in diesen Krieg verwickelt, in einem Waffengang, der erst nach sechs Jahren endete und mit dem Völkermord an den Juden eine bis dahin unbekannte Grausamkeit und Menschenverachtung erreichte. // Die Menschen hier in Polen haben entsetzlich gelitten unter diesem Krieg, der ihnen vom Deutschen Reich aufgezwungen worden war. Denn nach der militärischen Niederlage im Oktober 1939 setzte sich die Gewalt als Terror gegen die Zivilbevölkerung fort. Hitler wollte mehr als die Korrektur der Grenzen von Versailles - er suchte sogenannten "Lebensraum" für das deutsche Volk. Hitler wollte auch mehr als einen polnischen Vasallenstaat - er strebte die gänzliche Vernichtung des Staates an - die Auslöschung seiner führenden Schicht und die Ausbeutung der übrigen Bevölkerung. // Hitler nutzte Polen als Laboratorium für seinen Rassenwahn, als Übungsfeld für seine Unterdrückungs- und Vernichtungspolitik gegenüber Slawen und Juden. Fast sechs Millionen polnische Bürger wurden willkürlich erschossen oder systematisch liquidiert. Sie endeten in Gefängniszellen, bei der Zwangsarbeit, im Bombenhagel oder in den Konzentrationslagern. // Und noch etwas kennzeichnet dieses Land: Keine andere Nation hat in einem derartigen Umfang und so lange Widerstand geleistet. Polen wollten ihr Land eigenständig befreien. Polen wollten ein freies, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Land. // Als die Befreiung dann endlich kam, brachte sie der Nation jedoch weder Freiheit noch Unabhängigkeit. Polen zählte zu den Siegern, doch weder Freiheit noch Unabhängigkeit wurden Ihrem Land zuteil. Mit der sowjetischen Herrschaft folgte eine Diktatur auf die vorangegangene. Frei wurde Polen erst dank Solidarnosc. // Die bitteren Erfahrungen gerade der polnischen Nation zeigen: Wirklich in Frieden mit den Nachbarn leben nur Völker, die unabhängig und selbstbestimmt über ihr Schicksal entscheiden können. Wirklich in Frieden mit den Nachbarn leben nur Völker, die die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Anderen respektieren. // Heute dürfte es in Deutschland nur noch wenige Menschen geben, die persönliche Schuld für die Verbrechen des NS-Staates tragen. Ich selber war gerade fünf Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Aber als Nachfahre einer Generation, die brutale Verbrechen begangen oder geduldet hat, und als Nachfahre eines Staates, der Menschen ihr Menschsein absprach, empfinde ich tiefe Scham und tiefes Mitgefühl mit jenen, die unter den Deutschen gelitten haben. Für mich, für uns, für alle Nachgeborenen in Deutschland, erwächst aus der Schuld von gestern eine ganz besondere Verantwortung für heute und morgen. // Wenn die Beziehungen zwischen Völkern so tief von Unrecht, von Schmerz, von Arroganz und Demütigung geprägt waren wie bei Deutschen und Polen, ist eine Entfeindung alles andere als selbstverständlich. Die Annäherung zwischen unseren Völkern kommt mir daher wie ein Wunder vor. // Um dieses Wunder Wirklichkeit werden zu lassen, brauchte und braucht es Menschen, die politische Vernunft und einen starken Willen einbringen. Politische Vernunft, um den Weg weiter zu beschreiten, den Westeuropa 1950 mit der Schaffung einer europäischen Völkerfamilie begann und nach 1989 gemeinsam mit Mittel- und Osteuropa fortsetzte. Ferner den starken Willen, die schmerzhafte Vergangenheit wohl zu erinnern, aber letztlich doch hinter sich zu lassen - um einer gemeinsamen Zukunft willen. // Ich kenne die langen Schatten, mit denen Leid und Unrecht die Seelen der Menschen verdunkeln. Ich weiß, dass Leid betrauert werden will und dass Unrecht nach ausgleichender Gerechtigkeit ruft. Deshalb brauchen wir weiter den aufrichtigen Umgang mit der Vergangenheit, der nichts verschweigt und nichts beschönigt und den Opfern Anerkennung zuteilwerden lässt. Ich weiß allerdings auch, dass Wunden nicht heilen können, wenn Groll oder Ressentiments die Versöhnung mit der neuen Wirklichkeit verhindern und dem Menschen die Zukunft rauben. // Um eben dieser Menschen willen dürfen wir altem und neuem Nationalismus keinen Raum geben. Um eben dieser Zukunft willen lassen Sie uns weiter vereint das friedliche und demokratische Europa bauen und mit Dankbarkeit an jene Deutschen und Polen erinnern, die schon früh aufeinander zugingen: mutige Menschen in den evangelischen und katholischen Kirchen, in der Aktion Sühnezeichen, unter den Intellektuellen beider Länder. Gerade wir Deutschen werden nicht den Kniefall von Willy Brandt in Warschau vergessen, jene Geste der Demut, mit der er um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg bat. In unserer Erinnerung bleibt auch die Umarmung von Bundeskanzler Helmut Kohl und Premierminister Tadeusz Mazowiecki im schlesischen Kreisau - nur drei Tage nach dem Fall der Mauer 1989. Auf berührende Weise symbolisierte sie das Ende von Feindschaft, von Misstrauen, von Krieg und den Wunsch nach Verständigung und Aussöhnung. // Als sich vor genau fünf Jahren hier auf der Westerplatte 20 europäische Staats- und Regierungschefs versammelten, um gemeinsam der Gräuel des Zweiten Weltkriegs zu gedenken, sahen wir uns auf dem Weg zu einem Kontinent der Freiheit und des Friedens. Wir glaubten und wollten daran glauben, dass auch Russland, das Land von Tolstoi und Dostojewski, Teil des gemeinsamen Europa werden könnte. Wir glaubten und wollten daran glauben, dass politische und ökonomische Reformen unseren Nachbarn im Osten der Europäischen Union annähern und die Übernahme universeller Werte in gemeinsame Institutionen münden würden. // Wohl niemand hat damals geahnt, wie dünn das politische Eis war, auf dem wir uns bewegten. Wie irrig der Glaube, die Wahrung von Stabilität und Frieden habe endgültig Vorrang gewonnen gegenüber dem Machtstreben. Und so war es ein Schock, als wir mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass am Rande von Europa wieder eine kriegerische Auseinandersetzung geführt wird. Eine kriegerische Auseinandersetzung um neue Grenzen und um eine neue Ordnung. Ja, es ist eine Tatsache: Stabilität und Frieden auf unserem Kontinent sind wieder in Gefahr. // Nach dem Fall der Mauer hatten die Europäische Union, die NATO und die Gruppe der großen Industrienationen jeweils besondere Beziehungen zu Russland entwickelt und das Land auf verschiedene Weise integriert. Diese Partnerschaft ist von Russland de facto aufgekündigt worden. Wir allerdings wünschen uns auch in Zukunft Partnerschaft und gute Nachbarschaft. Aber die Grundlage muss eine Änderung der russischen Politik und eine Rückkehr zur Achtung der Prinzipien des Völkerrechts sein. // Weil wir am Recht festhalten, weil wir es stärken und nicht dulden, dass es durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird, stellen wir uns jenen entgegen, die internationales Recht brechen, fremdes Territorium annektieren und Abspaltung in fremden Ländern militärisch unterstützen. Und deshalb stehen wir ein für jene Werte, denen wir unser freiheitliches und friedliches Zusammenleben verdanken. Wir werden Politik, Wirtschaft und Verteidigungsbereitschaft den neuen Umständen anpassen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten lassen sich in diesen Grundfragen nicht auseinanderdividieren, auch nicht in der Zukunft. // Die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft nur vergrößern. Die Geschichte lehrt uns auch, dass aus unkontrollierter Eskalation eine Dynamik entstehen kann, die sich irgendwann der Steuerung entzieht. Und deshalb strebt Deutschland - wie die ganze Europäische Union - nach einer deeskalierenden Außen- und Sicherheitspolitik, die Prinzipienfestigkeit und Kompromissfähigkeit, Entschiedenheit und Elastizität miteinander verbindet - und die imstande ist, einer Aggression Einhalt zu gebieten ohne politische Auswege zu verstellen. // Europa steht vor neuen, vor großen Herausforderungen. Was wir augenblicklich erleben ist die Erosion alter Ordnungen und das Aufflackern neuer Formen von Gewalt an unserer Peripherie. Das gilt auch für den Nahen Osten und Nordafrika. Nur an wenigen Orten führte der Arabische Frühling zu Demokratie und Stabilität, vielerorts halten die Unruhen und die Machtkämpfe an. Starken Einfluss gewannen islamistische Gruppen, besonders gewalttätige Fundamentalisten setzten sich in Teilen von Syrien und im Irak durch. // Im Unterschied zu früheren Rebellionen geht es diesen Gruppen nicht um einen Machtwechsel im nationalstaatlichen Rahmen. Sie sind viel radikaler und zielen auf die Errichtung eines terroristischen Kalifats im arabischen Raum. Fanatisierte und brutalisierte Frauen und Männer aus unterschiedlichen Ländern missbrauchen die Religion und die Moral, um alle zu verfolgen und unter Umständen zu ermorden, die sich ihnen widersetzen - Muslime ebenso wie Andersgläubige. Unsere westlichen Staaten und Städte halten sie für Orte der Verderbnis. Die aus der Aufklärung erwachsene Gesellschaftsform der Demokratie wird von ihnen bekämpft und die Universalität der Menschenrechte, sie wird von ihnen geleugnet. // Verhinderung wie Bekämpfung dieses Terrorismus liegen ganz existentiell im gemeinsamen Interesse der Staatengemeinschaft und damit Europas. Erstens wegen der geographischen Nähe: Die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten kommen zu uns nach Europa, und die Terroristen werben neue Rekruten auch in unseren Staaten an. Zweitens, weil der Konflikt unsere europäischen Länder erreichen kann. Nicht auszuschließen ist, dass auch europäische Staaten zum Ziel islamistischer Angriffe werden. // Wenn wir den heutigen Jahrestag hier auf der Westerplatte gemeinsam begehen, so konfrontieren wir uns nicht nur mit dem, wozu Menschen im Zweiten Weltkrieg fähig waren. Wir konfrontieren uns heute gemeinsam auch ganz bewusst mit dem, wozu Menschen heute fähig sind. // Ja, uns führt heute das Gedenken zusammen, aber genauso stehen wir zusammen angesichts der aktuellen Bedrohungen. Niemand sollte daran zweifeln: Deutsche und Polen stehen beieinander und ziehen am selben Strang. Gemeinsam nehmen wir die besondere Verantwortung an, die uns mit den Konflikten in unserer Nachbarschaft zugewachsen ist. Wir handeln entsprechend und engagieren uns für friedliche Lösungen. // Auch die Europäische Union muss angesichts der neuen Herausforderungen zusammenstehen. Denn nur gemeinsam können wir das demokratische und friedliche Europa der Zukunft bauen. Und nur gemeinsam können wir es verteidigen.
-
Joachim Gauck
Liebe Bürgerinnen und Bürger hier im Land, liebe Landsleute in der Ferne, es ist Weihnachten. Viele von uns lesen und hören in diesen Tagen die Weihnachtsgeschichte. In dieser Geschichte um das Kind in der Krippe begegnen uns Botschaften, die nicht nur religiöse, sondern alle Menschen ansprechen: "Fürchtet Euch nicht!" und "Friede auf Erden!" // Wir sehnen uns nach Frieden - auch und gerade, weil in der Realität so viel Unfriede, so viel Krieg herrscht. // Vor wenigen Tagen bin ich aus Afghanistan zurückgekehrt. Es hat mich beeindruckt, wie deutsche Soldatinnen und Soldaten unter Einsatz ihres Lebens Terror verhindern und die Zivilbevölkerung schützen. Mein Dank gilt ihnen - wie auch den zivilen Helfern dort. // Eine solche Reise führt dem Besucher vor Augen, wie kostbar der Frieden ist, der seit über 60 Jahren in Europa herrscht. Gesichert hat ihn die europäische Idee. Zu Recht hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten. Jetzt aber ist die Frage: Wird unser politischer Wille zusammenhalten können, was ökonomisch und kulturell so unterschiedlich ist? // Deutschland hat die Krise bisher gut gemeistert. Verglichen mit anderen Europäern geht es den meisten von uns wirtschaftlich gut, ja sogar sehr gut. Zudem ist Deutschland politisch stabil. Radikale Parteien haben nicht davon profitiert, dass ein Teil der Menschen verunsichert ist. // Sie sind verunsichert angesichts eines Lebens, das schneller, unübersichtlicher, instabiler geworden ist. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, der Klimawandel erfordert ebenso neue Antworten wie eine alternde Gesellschaft. Sorge bereitet uns auch die Gewalt: in U-Bahnhöfen oder auf Straßen, wo Menschen auch deshalb angegriffen werden, weil sie schwarze Haare und eine dunkle Haut haben. // Angesichts all dessen brauchen wir nicht nur tatkräftige Politiker, sondern auch engagierte Bürger. Und - manchmal brauchen wir eine Rückbesinnung, um immer wieder zu uns und zu neuer Kraft zu finden. // Dazu verhilft uns Weihnachten. Für Christen ist es das Versprechen Gottes, dass wir Menschen aufgehoben sind in seiner Liebe. Aber auch für Muslime, Juden, Menschen anderen Glaubens und Atheisten ist es ein Fest des Innehaltens, ein Fest der Verwandten und Wahlverwandten, ein Fest, das verbindet, wenn Menschen sich besuchen und beschenken - mit schönen Dingen, vor allem jedoch mit Zuwendung. Wer keine Zuwendung erfährt und keine schenkt, kann nicht wachsen, nicht blühen. // In der Sprache der Politik heißt das: Solidarität. In der Sprache des Glaubens: Nächstenliebe. In den Gefühlen der Menschen: Liebe. // Ja, wir wollen ein solidarisches Land. Ein Land, das den Jungen Wege in ein gutes Leben eröffnet und den Alten Raum in unserer Mitte belässt. Ein Land, das jene, die seit Generationen hier leben, mit jenen verbindet, die sich erst vor Kurzem hier beheimatet haben. // Kürzlich hat mir eine afrikanische Mutter in einem Flüchtlingswohnheim ihr Baby in den Arm gelegt. Zwar werden wir nie alle Menschen aufnehmen können, die kommen. Aber: Verfolgten wollen wir mit offenem Herzen Asyl gewähren und wohlwollend Zuwanderern begegnen, die unser Land braucht. // Bei meinen zahlreichen Begegnungen in den vergangenen Monaten durfte ich etwas sehr Beglückendes erfahren: dass die Zahl der Menschen, die unsere Gegenwart und Zukunft zum Besseren gestalten, weit größer ist als die Zahl der Gleichgültigen. Mein Dank gilt deshalb den engagierten Frauen und Männern. Ihre Tatkraft bestärkt mich - besonders aber stärkt sie unser Land, weil sie es schöner, liebenswerter, menschlicher macht. // Der Stern aus der Weihnachtsgeschichte führte Menschen einst von fernher zu einem ganz besonderen Ziel - zu einem Menschenkind. Einen solchen Stern wünsche ich jedem in unserem Land. Einen Stern, der ihn zum Mitmenschen, der uns zueinander führt. // Mit diesem Wunsch also: gesegnete Weihnachten!
-
Joachim Gauck
Meine Damen und Herren, aus dem Schloss Bellevue in Berlin wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. // Millionenfach sagen in diesen Tagen Menschen einander gute Wünsche. Wir möchten, besonders in diesen weihnachtlichen Stunden des Friedens und des Glanzes, dass es allen gut geht, dass möglichst alle begleitet, dass alle beschützt und behütet sein mögen. // Unsere Verwandten, Eltern und erwachsenen Kinder, unsere Freunde und alle, die uns wichtig sind: Viele sehen wir im Laufe des Jahres nur mehr selten. Aber alle, so sagen wir es ihnen, persönlich oder am Telefon, elektronisch oder auf Papier: Allen soll es in diesen Tagen gut gehen. // Es gibt ein tiefes Wissen im Menschen: Gelungenes Leben ist Leben in Verbundenheit mit anderen Menschen. Wir wollen uns angenommen und eingebettet fühlen in Familien oder Wahlfamilien. Hass und Krieg zerstören das Miteinander - Weihnachten aber stärkt die Hoffnung und die Sehnsucht danach, in Frieden und Einklang mit unseren Mitmenschen leben zu können - auch bei Menschen anderer Religionen und auch bei Menschen, die ohne Glauben leben. Wenn dies gelingt, auch im Kleinen, dann sind wir dankbar. Wir wissen ja, wie selten und kostbar die wirklich guten Tage in manchem Leben sind. // Wir wissen: Ein friedliches, glanzvolles Weihnachten ist vielen Menschen nicht beschert. Das war so, seit es Weihnachten gibt. Die da einst nach Bethlehem zogen - sie waren ja arm, statt Haus und Bett mussten sie mit Stall und Futtertrog vorlieb nehmen. Wahrlich keine Idylle! Und nach der Geburt des besonderen Kindes waren sie alsbald auf der Flucht - nur so war das Leben des Kindes zu retten. // Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen: Krieg und Hunger, Verfolgung und Not. Unsere eigenen Vorfahren haben das alles gekannt. Im 19. Jahrhundert sind sie zu Millionen in die Neue Welt ausgewandert und nach dem Zweiten Weltkrieg mussten Flüchtlinge und Vertriebene sich eine neue Heimat suchen. // Auch heute sind Menschen an vielen Orten der Welt auf der Flucht. Wir denken an das schreckliche Schicksal der Familien aus Syrien, wir denken an die Verzweifelten, die den gefährlichen Weg nach Europa über das Wasser wagen. Wir denken auch an die Menschen, die kommen, weil sie bei uns die Freiheit, das Recht und die Sicherheit finden, die ihnen in ihren Ländern verwehrt werden. // Seit Menschengedenken sind alle Flüchtlinge erfüllt von der Sehnsucht nach dem besseren Leben. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, kommen nicht mit der Erwartung, hier in ein gemachtes Bett zu fallen. Sie wollen Verfolgung und Armut entfliehen und sie wollen Sinn in einem erfüllten Leben finden. // Machen wir unser Herz nicht eng mit der Feststellung, dass wir nicht jeden, der kommt, in unserem Land aufnehmen können. Ich weiß ja, dass dieser Satz sehr, sehr richtig ist. Aber zu einer Wahrheit wird er doch erst, wenn wir zuvor unser Herz gefragt haben, was es uns sagt, wenn wir die Bilder der Verletzten und Verjagten gesehen haben. Tun wir wirklich schon alles, was wir tun könnten? // Ich bin im letzten Jahr an vielen Orten auf das größte Geschenk gestoßen, das unser Land sich selbst gemacht hat - die Ehrenamtlichen. Sie helfen in beeindruckender Weise bei Naturkatastrophen wie der großen Flut in diesem Sommer. Sie lindern Armut und verhindern Ausgrenzung. Sie kümmern sich um kulturelle Werte, fördern den Breiten- und Behindertensport, verteidigen Menschen- und Bürgerrechte, helfen Menschen, besser zu leben oder begleitet zu sterben. Sie sind das große Geschenk für Deutschland. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie unser Land so lebenswert machen. // An Weihnachten, so geht die Geschichte, verkündeten Engel einst "Friede auf Erden!" Die Engel sind nach dieser Botschaft heimgekehrt. Hier auf Erden sind nun wir Menschen selber damit betraut, diese Verheißung immer wieder in die Tat umzusetzen. Das muss unsere Sache sein: Friede auf Erden - damit die Welt uns allen eine Heimat sein kann. In diesem Sinne lassen Sie uns miteinander Weihnachten feiern!
-
Joachim Gauck
Übermorgen ist es siebzig Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging - jener mörderische Schrecken, der von Deutschland ausgegangen war. // Der Krieg ging endlich zu Ende, der unseren Kontinent verwüstete, in dem die Juden Europas ermordet wurden, in dessen Verlauf Millionen von Soldaten und Zivilisten starben, in dessen Folge in vielen Ländern Millionen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, als dessen Ergebnis Europa, mitten darin Deutschland, ein halbes Jahrhundert geteilt war. // Dieser Krieg endete erst, als die westlichen Alliierten und die Sowjetunion gemeinsam Deutschland zur Kapitulation gezwungen hatten und uns Deutsche damit auch von der Nazi-Diktatur befreiten. Wir Nachgeborenen in Deutschland haben allen Grund, für diesen aufopferungsvollen Kampf unserer ehemaligen Gegner in Ost und West dankbar zu sein. Er hat es möglich gemacht, dass wir in Deutschland heute in Freiheit und Würde leben können. Wer wäre nicht dankbar dafür? // Hier in Schloß Holte-Stukenbrock erinnern wir in dieser Stunde an eines der größten Verbrechen in diesem Krieg: Millionen von Soldaten der Roten Armee sind in deutscher Kriegsgefangenschaft ums Leben gebracht worden - sie gingen an Krankheiten elendig zugrunde, sie verhungerten, sie wurden ermordet. Millionen von Kriegsgefangenen, die doch nach Kriegsvölkerrecht und internationalen Verabredungen in der Obhut der Deutschen Wehrmacht standen. // Sie wurden auf lange Fußmärsche gezwungen, in offenen Güterwagen verschickt, sie kamen in sogenannte Auffang- oder Sammellager, in denen es anfangs so gut wie nichts gab - keine Unterkunft, keine ausreichende Verpflegung, keine sanitären Anlagen, keine medizinische Betreuung -, nichts. Sie mussten sich Erdlöcher graben, sich notdürftig Baracken bauen - sie versuchten verzweifelt, irgendwie zu überleben. Dann wurden sie in großer Zahl zum Arbeitseinsatz gezwungen, den sie, geschwächt und ausgehungert, wie sie waren, oft nicht zu überleben vermochten. // Wenige hundert Meter von hier war das Kriegsgefangenenlager "Stalag 326 Senne". Mehr als 310.000 Kriegsgefangene waren hier. Sehr viele von ihnen sind umgekommen, Zehntausende sind hier begraben. // Was sagen Zahlen? Wenig - und doch, sie geben Auskunft, sie geben uns zumindest eine Vorstellung von dem Schrecken und von der unbarmherzigen Behandlung, die die Sowjetsoldaten in deutscher Gefangenschaft erlitten haben. Wir müssen heute davon ausgehen, dass von über 5,3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen deutlich mehr als die Hälfte umkam. Millionen Schicksale, Millionen Namen, Millionen Lebensgeschichten. Es waren Russen, Ukrainer, Weißrussen, Kirgisen, Georgier, Usbeken, Kasachen, Turkmenen - Soldaten aus allen Völkern, die damals zur Sowjetunion gehörten. // Wenn wir betrachten, was mit den westalliierten Kriegsgefangenen geschah, von denen etwa drei Prozent in der Gefangenschaft umkamen, dann sehen wir den gewaltigen Unterschied: Anders als im Westen war der Krieg im Osten vom nationalsozialistischen Regime von Anfang an als ein Weltanschauungs- und Vernichtungs- und Ausrottungskrieg geplant - und in der Regel auch geführt, denken wir zum Beispiel an diese schreckliche jahrelange Belagerung Leningrads mit dem Ziel des Aushungerns einer Millionenstadt. Denken wir an die Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung in allen besetzten Ländern, ganz besonders aber in der Sowjetunion. Das geschah bewusst und vorsätzlich und auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers. Die Wehrmacht setzte diese Befehle bereitwillig um. Es war der Generalstabschef Halder, der im Mai 1941 formulierte: "Wir müssen von dem Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad". Dementsprechend sollten die Gefangenen behandelt werden, und das ist bei den Völkern der ehemaligen Sowjetunion bis heute in unauslöschlicher Erinnerung. // Als die Sowjetunion sich ganz zu Beginn des Krieges bereit erklärt hatte, über das Rote Kreuz mit dem Deutschen Reich eine Vereinbarung über die Behandlung der Kriegsgefangenen zu schließen, da lehnte Hitler das brüsk ab - und er sorgte dafür, dass seine Ablehnung in Millionen von Flugblättern auch seinen Soldaten bekannt wurde. Denn er hatte ein Ziel, und es war eindeutig: Kein deutscher Soldat sollte glauben, dass er in sowjetischer Kriegsgefangenschaft überhaupt überleben könnte. Alle sollten bis zum letzten Atemzug kämpfen und sich auf keinen Fall ergeben. Das Schicksal derjenigen seiner Soldaten, die dann doch gefangen wurden, war dem Obersten Befehlshaber vollkommen gleichgültig. // Nun schauen wir auf die andere Seite. Auf der anderen Seite dekretierte Stalin: Wenn ein sowjetischer Soldat gefangen werde, habe er nicht bis zuletzt gekämpft, konnte gleichsam also nur desertiert sein, also irgendwie ein Verrätersein. Deswegen erwarteten bei Kriegsende sehr viele in die Heimat entlassene sowjetische Kriegsgefangene erneute Lagerhaft, oft sogar der Tod. Wir können nur ahnen, wie viele Mütter, wie viele Ehefrauen, wie viele Bräute, wie viele Kinder noch nach Kriegsende vergeblich gewartet haben; und auch wie schwer es für sie war, damals dieser ihrer Toten zu gedenken. // Als Deutsche fragen wir uns aber zuerst nach deutscher Schuld und Verantwortung. Und für uns bleibt festzuhalten, dass der millionenfache Tod derer, die unter der Verantwortung der Deutschen Wehrmacht starben, "eines der größten deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs" gewesen ist. Viele wollten das nach dem Krieg noch sehr lange Zeit nicht wahrhaben. Aber spätestens heute wissen wir: Auch die Wehrmacht hat sich schwerer und schwerster Verbrechen schuldig gemacht. // Aus mancherlei Gründen ist dieses grauenhafte Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland nie angemessen ins Bewusstsein gekommen - es liegt bis heute in einem Erinnerungsschatten. Das mag damit zu tun haben, dass die Deutschen in den ersten Jahren nach dem Krieg vor allem an ihre eigenen Gefallenen und Vermissten gedacht haben, auch an die Kriegsgefangenen, die zum Teil noch bis 1955 in der Sowjetunion festgehalten wurden. // Das mag sicher auch daran liegen, dass die Schreckensbilder von der Eroberung des deutschen Ostens durch die Rote Armee vielen Deutschen den Blick auf die eigene Schuld verstellten. Diejenigen, die wegschauen und sich nicht erinnern wollten, sahen sich dann zudem später durch die Besatzungs- und Expansionspolitik der Sowjetunion und durch die Errichtung einer kommunistischen Diktatur mit Rechtsferne, Unfreiheit und Unterdrückung in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands bestätigt. In der DDR wurde zwar die Erinnerung an das heldenhafte sowjetische Brudervolk groß geschrieben, aber der amtlich verordnete Heldenmythos ließ auf der anderen Seite wenig Raum für die Empathie mit denjenigen, die als Kriegsgefangene in Deutschland keine strahlenden Sieger waren, sondern Opfer, Entrechtete, Geschlagene. // In späteren Jahren haben in Westdeutschland und auch im wiedervereinigten Deutschland die Erinnerung an den Völkermord an den Juden und die beginnende Scham darüber die Auseinandersetzung mit anderen Verbrechen einfach überlagert. // Dabei sind doch die Verbrechen des Nationalsozialismus zutiefst miteinander verbunden. Sie haben alle dieselbe Wurzel: Sie stammen aus der Vorstellung, dass auch unter Menschen nur das Recht des Stärkeren gelte, und dass der Stärkere das Recht habe, über das Lebensrecht der Anderen zu entscheiden, über Wert, über Unwert ihres Lebens. So wurden die Juden, wie die Sinti und Roma ausgesondert, gedemütigt, ermordet, dann die Behinderten oder Homosexuellen. So wurden dann auch die Völker im Osten als "minderwertig" diffamiert, weswegen man mit ihnen ohne Rücksicht auf Humanität und Menschenrechte, auch ohne Rücksicht auf die Regeln des Völker- und Kriegsrechts verfahren dürfe. // Im Protokoll der Besichtigung eines Kriegsgefangenenlagers durch Propagandaminister Goebbels hält ein Regierungsbeamter fest: // "Der Zweck der Fahrt sollte sein, [ ] einmal die in den Wochenschauen gezeigten Untermenschen in Natur vorzuführen. [ ] // Die Fahrt brachte insofern nicht das gewünschte Ergebnis, als die Gefangenen fast durchweg Weißrussen waren und daher durchschnittlich ein durchaus menschliches Aussehen hatten. [ ] // Sie bekommen außerordentlich wenig Beköstigung und haben Tag und Nacht keinerlei Schutz vor dem Wetter. Meines Erachtens werden diese Gefangenen sowieso hinter ihrem Drahtzaun verrecken. [ ]" // Hybris, Allmachtswahn, Herrenmenschentum, Zynismus, das sind die Kennzeichen nationalsozialistischer Ideologie und eben auch nationalsozialistischer verbrecherischer Praxis. // Erschütternd ist immer noch, wenn wir sehen, in wie kurzer Zeit ganz normale Männer und Frauen, einmal mit dieser Ideologie vergiftet, zu Komplizen der Unterdrückungspraxis gemacht werden und manche sogar zu unbarmherzigen Menschenschindern und Mördern werden konnten. // Wir stehen hier und erinnern an dieses barbarische Unrecht und an die Verletzung aller zivilisatorischer Regeln. Wir erinnern daran im Namen der Humanität, im Namen der Gleichheit und der Würde, die unterschiedslos allem zukommt, was Menschenantlitz trägt. Im Namen der Menschenrechte, die uns verpflichten, die uns binden und leiten und für deren Geltung wir eintreten, stehen wir hier. // Wir sind an einer Stätte versammelt, an der auf den ersten Blick kaum etwas das Ausmaß dessen erkennen lässt, weswegen wir hier sind. Gedenksteine markieren Gräberreihen, die längst von Gras bewachsen sind. Es scheint so, als habe die vergangene Zeit fast jede sichtbare und fühlbare Erinnerung an das ausgelöscht, was hier einst Menschen Menschen angetan haben. // So wie wir hier in Schloß Holte-Stukenbrock unsere Erinnerung und unser historisches Gedächtnis anstrengen müssen, damit wir auf dieser Grasfläche einen Schreckensort für hunderttausende Menschen erkennen können, so geht es uns wohl überhaupt mit dem Eingedenken vergangenen Leids: Was spurlos verwehen sollte, das rufen wir in unser Gedächtnis. Wenigstens vor unserem inneren Auge soll in Umrissen noch einmal aufscheinen, was hier furchtbare Wirklichkeit war, was uns durch Fotos, Statistiken, Karteikarten, Erzählungen, Augenzeugenberichte unabweisbar und unwiderlegbar sagt: Das ist hier geschehen, mitten in Deutschland. Und es ist ja nicht irgendwie"geschehen". Es wurde "gemacht", es wurde "verübt", planmäßig und mit bösem Kalkül und ewig unfassbar. Von Menschen, mit denen wir Sprache, Herkunft und Nationalität teilen, von Menschen, deren Verbrechen heute Teil unserer Geschichte sind. // Wir müssen unseren Willen anstrengen, um die Wahrheit auszuhalten, um nicht immer unwillkürlich zu denken: Das kann doch unmöglich wahr sein - das, was hier im "Stalag 326" und an hunderten von anderen, über ganz Deutschland verteilten Orten menschenmöglich war -, und was hier aber doch tatsächlich stattgefunden hat. // Wir müssen aber nicht nur unseren Verstand anstrengen, nicht nur unser Vorstellungsvermögen aktivieren und unsere historischen Kenntnisse erweitern. Wir müssen - zuerst und zuletzt - auch unser Herz und unsere Seele öffnen für das, was wir kaum glauben wollen. Es geht um eine wirkliche Empathie, ein wirklich bewegendes, unser Inneres, unser Herz, unsere Seele bewegendes Gedenken. // Ich danke heute ganz ausdrücklich allen dafür, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für ein solches immer neues Bewusstmachen und Einfühlen eingesetzt haben. Es waren ehrenamtlich Engagierte, die Spuren ausfindig gemacht und Erinnerung wachgehalten haben. // Damit diese Erinnerung nicht verwelkt, darum gab und gibt es die Initiative "Blumen für Stukenbrock", darum gibt es jetzt, dank unermüdlicher, überwiegend ehrenamtlicher Initiative die Dokumentationsstätte. Es gibt einen vorbildlich engagierten Förderverein, kundige Führungen und Ausstellungen. Angehörige von Opfern, die von weit her kommen und nach Spuren der Erinnerung an ihre Väter oder Großväter suchen, sie werden liebevoll betreut und begleitet. // Einer, der selber als Gefangener hier war, Leo Frankfurt, ist heute hier und wird gleich noch zu uns sprechen. Es bewegt mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Frankfurt. Es ist so etwas wie ein gnädiges Geschenk an uns, es beschämt uns und es beglückt uns gleichzeitig. Danke! // Und es sind unter uns Mitglieder der Familie Basanov, deren Vater, Schwiegervater und Großonkel Basan Erdniev hier Lagerhäftling war und hier begraben ist. Wir haben eben kurz inne gehalten an der Stelle, an der Sie sich erinnern an Ihren Vater. Auch für Ihr Kommen, liebe Familie Basanov, bedanke ich mich und freue mich sehr, dass Sie mich an diesem Tag begleiten und unter uns sind. // Zu den Initiativen, die hier wertvolles Engagement beweisen, gehört auch die Geschichts-AG des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock. Es gibt das Anne-Frank-Projekt und das schulübergreifende Theaterprojekt. Alle diese jungen Menschen haben die Aufgabe übernommen, die Erinnerung weiter zu tragen. Das gilt auch für die Polizeischüler, die hier ausgebildet werden, und die sich sehr genau bewusst sind, was die Geschichte dieses Ortes bedeutet. Und gekommen sind heute auch junge Soldaten der Bundeswehr, für die historisches Bewusstsein selbstverständlich ist. // Es gab und gibt, dank der freiwilligen Initiativen hier und an anderen, ähnlichen Orten in unserem ganzen Land, diesen hartnäckigen, alltäglichen Widerstand gegen das Vergessen. Das ist gut so, das gehört zu unserer Kultur. So sind heute auch Vertreter der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste hier, auch Vertreter von Gegen Vergessen/Für Demokratie und vom Deutsch-Russischen Museum Karlshorst. Ihnen und den Vielen, die in unserem Land selbstlose Erinnerungs- und Gedenkarbeit leisten, danke ich heute und hier ganz ausdrücklich. Sie helfen bei einer Aufgabe, die sich auch siebzig Jahre nach Kriegsende noch stellt: auch das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Erinnerungsschatten heraus zu holen. // Nicht weit von hier stehen wir vor dem Gelände, das Tod und Verderben gebracht hat, auf dem die Schreie, das Seufzen und das Stöhnen der geschundenen Leiber und Seelen unsichtbar eingeschrieben bleiben. // Dies ist einer der Orte, an denen wir schmerzhaft und intensiv empfinden, dass die Toten für die Lebenden eine Verpflichtung sind. Sagen wir also heute, siebzig Jahre nach dem Ende des Krieges, "Ja"zu dieser Verpflichtung. Versprechen wir uns gegenseitig, dass wir, was an uns ist, tun, um ein menschenwürdiges und friedliches Leben für alle zu ermöglichen und zu beschützen.
-
Joachim Gauck
Vor genau vier Wochen - einige haben mich schon darauf angesprochen - stand ich auf dieser Bühne. Damals feierten wir den Jahrestag der friedlichen Wiedervereinigung unseres Landes. Ein festliches Ereignis - ähnlich wie heute. Denn heute ist ein besonderer Tag, weil wir eine Organisation feiern, die nach Jahrzehnten der Teilung in Ost und West 1991 selbst eine Wiedervereinigung erlebt hat. Eine Organisation, die über 150 Jahre hinweg Deutschland und die Deutschen durch ihre so wechselvolle Geschichte begleitet hat: das Rote Kreuz. // Ein rotes Kreuz auf weißem Grund steht für Schutz und Hoffnung in Zeiten der Not. Es steht für den Schutz von Schwachen und Bedürftigen. Es ist eines der bekanntesten - und bemerkenswertesten - Symbole, die es überhaupt gibt. Denn am Anfang der Geschichte der Bewegung des Roten Kreuzes stand das Mitgefühl eines Mannes für das Leid der Soldaten im 19. Jahrhundert, als der Krieg - an der Krim und schließlich in Oberitalien - nach Europa zurückgekehrt war. Die Schlacht von Solferino im Jahr 1859 und ihre über 40.000 Verwundeten und Toten erschütterten den Genfer Geschäftsmann Henry Dunant so sehr, dass er sofort Hilfsmaßnahmen für die verwundeten Soldaten in die Wege leitete. Immer wieder begründete er seinen Einsatz mit den italienischen Worten: tutti fratelli - wir sind doch alle Brüder! Aus diesem Zusammengehörigkeitsgefühl entstand dann eine neue Bewegung, die beispielhaft für das steht, was wir heute humanitäre Hilfe nennen. // Natürlich gab es dafür Vorzeichen und Vorläufer: Dass verwundete Soldaten des Schutzes bedurften, diese Vorstellung hatte sich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aber mit dem Rotkreuzgedanken setzte Henry Dunant entschlossen dem Grauen des Krieges tätige Mitmenschlichkeit und christliche Nächstenliebe entgegen. Die Rotkreuzbewegung steht so nicht nur für die beflügelnde Kraft des Mitgefühls, sondern auch für die Macht eines Einzelnen. Und diese Kraft verbreitete sich aus Genf in ganz Europa und später in der Welt. // Schon im November 1863 - vor 150 Jahren also - wurde der erste Rotkreuzverein auf deutschem Boden, hier in Stuttgart gegründet: der Württembergische Sanitätsverein. Deshalb sind wir hier versammelt, um diese wirkmächtige Idee, die auch in unserem Land sich so kraftvoll entfaltet hat, zu würdigen: Tutti fratelli, alle sind Brüder - e sorrelle, und Schwestern! Natürlich! Ja, gerade hier in Deutschland knüpfte die Rotkreuzbewegung auch an die Tradition der Frauenvereine aus der Zeit der Befreiungskriege an. // In Deutschland hat das Rote Kreuz einen historischen Beitrag dazu geleistet, dass sich eine bürgerliche Gesellschaft entwickelte, die ihre Geschicke selbst in die Hand nahm und nicht alles dem Staat überließ. Das Deutsche Rote Kreuz steht damit in einer Reihe mit anderen Institutionen des bürgerschaftlichen Engagements, der bürgerschaftlichen Selbstorganisation: den freien Wohlfahrtsverbänden, den freien Gewerkschaften und den eigenständigen Industrie- und Handelskammern. // Gerade mit den Erfahrungen der deutschen Vergangenheit erkennen wir heute den Wert eines freien zivilen Mitgliederverbands für unsere Demokratie: Nach der "Gleichschaltung", wenn wir an die NS-Zeit erinnern, und auch nach der Freiheitseinschränkung - und ich sage dies trotz einiger innerer Freiräume - in der DDR wurde im wiedervereinigten Deutschland das ganze Rote Kreuz ein aktives Bündnis freier, verantwortungsbewusster Bürger. // Tätig werden, statt untätig zu verharren - die Dinge in die Hand nehmen, statt sie klaglos hinzunehmen - das ist die Handlungsmaxime des Deutschen Roten Kreuzes: Ob in der Pflege oder in der Betreuung älterer Menschen, in der sozialen Arbeit mit Jugendlichen oder in der Beratung von Zugewanderten - das Deutsche Rote Kreuz ist für alle da. Vielen begegnet es bei Erste-Hilfe-Kursen oder bei freiwilligen Blutspenden. Es leistet Notfallhilfe und Katastrophenschutz. Ein Beispiel: Als die Flüsse in diesem Jahr erneut über die Ufer traten und große Teile Deutschlands überschwemmten, da war das Deutsche Rote Kreuz wie selbstverständlich zur Stelle. Damit trägt das Rote Kreuz dazu bei, dass wir uns sicher fühlen. Wir wissen: Ich erhalte Hilfe in der Not oder in der Krise. So stiftet das Deutsche Rote Kreuz gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist zu einem Markenzeichen für die soziale Dimension in unserem Land geworden. // Welchen Stellenwert das Deutsche Rote Kreuz hier hat, das zeigt uns auch die Zahl seiner Mitglieder: fast vier Millionen sind es. Besonders freue ich mich darüber, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger im Roten Kreuz ehrenamtlich engagieren - es sind über 400.000. Ihnen, den Ehrenamtlichen, möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen. Als Bürger helfen Sie Bürgern. Sie sind stets dort zur Stelle, wo Sie gebraucht werden. Eine vitale Bürgergesellschaft lebt von diesem Engagement. // Das Deutsche Rote Kreuz spielt, auch dies sei erwähnt, eine bedeutende Rolle für das Gesundheits- und Sozialwesen. Es betreibt Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Pflegeheime, steht dabei im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen und bringt seine Stimme ein in die Diskussionen, wie unser Sozialstaat auch künftig jedem medizinische Versorgung auf dem Stand der Wissenschaft und menschenwürdige Pflege garantieren kann. Das bedeutet für eine Organisation wie das Rote Kreuz auch besondere Herausforderungen - nämlich das Gemeinnützige und das Ehrenamtliche in eine Balance mit dem Geschäftlichen und den Hauptamtlichen zu bringen. Das setzt ein klares Leitbild voraus und Transparenz - wie Sie beim Deutschen Roten Kreuz sich das vorgenommen haben. Bei Ihrem Wirken für das Soziale in unserem Land helfen Sie so, die ideellen Werte des Deutschen Roten Kreuzes zu bewahren. // Weltweit ist das DRK humanitärer Botschafter unseres Landes. Als ich vor vier Wochen hier in diesem Saal sprach, habe ich auch über die Verantwortung Deutschlands in der Welt geredet. Dass das wiedervereinigte Deutschland als international angesehener und verlässlicher Partner gilt, dazu hat übrigens auch die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes einen wichtigen Beitrag geleistet. // Humanitäre Hilfe - das bedeutet, mit Henry Dunant im Kern daran zu glauben, dass wir im Stande sind, die Welt aus eigener Kraft zu verändern, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Heute geht es in der internationalen Politik nicht mehr nur um die Sicherheit von Staaten. Es geht auch um die Sicherheit des Einzelnen oder von den Vielen. Das ist eine wesentliche Errungenschaft der Weltgemeinschaft. Und wir sollten es ruhig aussprechen: Es ist ein Erfolg auch unserer Wertegemeinschaft, es ist auch ein Erbe der europäischen Aufklärung in einer Welt, die entgegen mancher Erwartung nach 1989 nicht friedlicher geworden ist. Tatsächlich erleben wir seither doch eine Fülle neuer Konflikte: zunehmend nicht nur zwischen Staaten, sondern innerhalb von Staaten zwischen unterschiedlichen Interessengruppen oder politischen, ethnischen und religiösen Gruppierungen. Einzelne fragile Staaten können die Sicherheit ihrer eigenen Bürger überhaupt nicht mehr gewährleisten. Oftmals haben sie auch gar kein Interesse daran. Dies stellt die weltweite humanitäre Hilfe vor ganz neue Herausforderungen. // Was das bedeutet, das habe ich auch bei meiner Begegnung mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Peter Maurer, erfahren. Das Internationale Komitee mit seinem ganz besonderen Mandat im Völkerrecht ist ein unverzichtbarer Partner der Bundesregierung in ihrer humanitären Hilfe - denken wir allein an die humanitäre Krise in Syrien. Deutschland gehört dort zu den größten Geldgebern und arbeitet eng mit dem Roten Kreuz zusammen. // In Syrien wie an vielen anderen Brennpunkten müssen wir uns fragen: Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Frieden möglich ist und in dem die Ursachen von Gewalt und damit von individuellem Leid verschwinden oder doch zumindest eingehegt werden? // Durch seine Prinzipien steht das Rote Kreuz beispielhaft für gelungene internationale Kooperation - nicht nur über Landesgrenzen hinweg, sondern auch zwischen den Weltreligionen. Die Rotkreuz- und die Rothalbmondgesellschaften genießen gleiche Rechte und Pflichten und sind in vielen Krisenregionen die einzigen Organisationen, die von allen Konfliktparteien anerkannt und respektiert werden. // Es ist entscheidend, dass das Rote Kreuz - ebenso wie der Rote Halbmond - auch weiterhin als Schutzsymbole akzeptiert werden, die eine unüberwindbare Grenze für Gewalt und Aggression darstellen. Übergriffe, welcher Art auch immer, auf Mitarbeiter des Roten Kreuzes können wir nicht hinnehmen. Nur wenn dieser Schutz gewährleistet ist, können Hilfsorganisationen ihrer Aufgabe nachkommen. Nur dann kommt eben die Hilfe bei den Bedürftigen an. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds setzen Leib und Leben aufs Spiel, um anderen Menschen zu helfen und das verdient doch unsere Unterstützung - und zwar unsere volle Unterstützung. // Nun könnte man sagen: Der humanitäre Gedanke, wie wir ihn heute kennen, hat sich in Europa entwickelt, auch weil der Kontinent so zahlreiche und so grausame kriegerische Auseinandersetzungen erlebt hat. Die Staaten Europas haben sich nach diesem schmerzvollen Weg miteinander versöhnt. Humanitäre Hilfe war nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges wesentlich für den Aufbau des Kontinents - das Rote Kreuz hat einen besonderen, einen ganz besonders "menschlichen" Beitrag in dieser Zeit geleistet, indem es half, Familien zusammenzuführen, die in den Wirren des Krieges auseinandergerissen worden waren. Ich habe noch in Erinnerung, wie wir, als ich ein Junge war, an den Radiogeräten saßen und ganze Namenslisten verlesen wurden. Der Suchdienst hat hier unglaublich dabei geholfen, Menschen zusammenzuführen, die durch Krieg und Kriegsfolgen auseinandergerissen waren. Aus dieser Zeit erinnere ich mich auch an die humanitären Aktionen, die Deutschland geholfen haben nach dem Krieg, etwa an die Schwedenspeisung im Hungerwinter 1946/47. Mit Lebensmittelpaketen, Kleidung und Schuhen halfen Schweden, Dänen, Schweizer, Briten und viele andere über die Rotkreuzorganisationen den Deutschen in ganz existenzieller Not. Ich möchte nicht, dass Deutschland vergisst, wie ihm einst geholfen wurde. Das war schließlich über die Hilfe für das schiere Überleben hinaus eine große Geste der Humanität, in der sich wieder Henry Dunants kraftvoller Gedanke zeigte: tutti fratelli e sorrelle - wir sind Schwestern und Brüder. An diese Erfahrung der Deutschen möchte ich heute dankbar erinnern. // Humanitäre Hilfe bedeutet, auf der Grundlage von Werten und Überzeugungen zu handeln. In diesem Grundsatz, den man auf Vieles übertragen kann, sehe ich eine Zukunftsaufgabe für uns in Europa. Wir als Europäer müssen unsere eigenen Werte ernst nehmen und ihnen auch in unserem praktischen Handeln folgen. Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den vielen Versuchen überall in der Welt, den Geltungsbereich der Menschenrechte etwa einzuschränken. Das geschieht beispielsweise unter Verweis auf distinkte "kulturelle Konventionen" oder "traditionelle Werte", die angeblich nicht mit den Menschenrechten übereinstimmen würden. Aber das ist immer unrichtig. Das ist immer taktisches Kalkül von Menschen, die sich davor fürchten, allen Menschen Menschenrechte und Bürgerrechte zuzuerkennen. Es gibt nicht zwei Arten von Menschenrechten. Die Vereinten Nationen haben sich auf eine Liste, auf einen Katalog geeinigt. Deshalb sind Menschenrechte nicht verhandelbar. Sie sind universell. Sie gelten überall und für jede Frau, für jedes Kind, für jeden Mann. // Bei der Durchsetzung der Menschenrechte sind wir ein großes Stück vorangekommen. Doch auch diese Geschichte, die Geschichte dieser Rechte, ist noch nicht zu Ende. Sie ist es schon deshalb nicht, weil Menschenrechte offensichtlich immer wieder aufs Neue erstritten werden müssen. // Und da sind wir alle gefordert: Wir erleben gerade zutiefst schockierende Tragödien an den Außengrenzen der Europäischen Union. Dazu können wir doch nicht schweigen, wenn wir unsere eigenen Werte ernst nehmen. Wir müssen uns fragen: Wie begegnen wir jenen, unseren Schwestern und Brüdern menschlicher, die sich aus Leid und Verzweiflung auf den Weg nach Europa gemacht haben und vor unseren Grenzen in akute Not geraten sind? Wie gehen wir mit denen um, die bei uns Schutz suchen? Wie gestalten wir die notwendigen Verfahren schnell und fair? Und ich möchte die Frage hinzufügen: Wie gestalten wir auch die oft notwendige Ablehnung von Asyl menschlicher? Welche Perspektiven bieten wir Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind? Gewiss, wir wissen es doch alle, wir werden nicht alle Menschen aufnehmen können, die auf der Welt in Not sind. Aber wir können mehr tun, und wir können es menschlicher tun. // An einer gesamteuropäischen Verantwortung für die Sicherheit in den Gewässern des Mittelmeers darf kein Zweifel bestehen. Der Schutz jedes einzelnen Menschenlebens geht allem voran. // Wir sollten uns von dem Idealismus, mit dem die Mitarbeiter des Roten Kreuzes ihre Aufgaben angehen, inspirieren lassen. Wir müssen zugleich abwägen, was realistischer Weise möglich ist - auch das gehört zu verantwortungsvollem Handeln. Doch mit Toleranz, ehrlichem Mitgefühl und einem offenen Auge für die Nöte anderer Menschen, ob nah oder fern, wird es uns gelingen, noch weiter auf diesem Weg zu einer friedlicheren und gerechten Welt voranzukommen. // Sie, meine Damen und Herren, bitte ich: Führen Sie Ihre Arbeit zum Wohl der Menschen, die Hilfe benötigen, auch weiterhin mit Energie, mit Hingabe und mit Weitsicht fort. Ich danke allen Haupt- und Ehrenamtlichen für ihren großen Einsatz. // Aber einen Satz muss ich noch hinzufügen: Heute, da dürfen Sie auch einmal stolz sein, in dieser großartigen Institution mitzuarbeiten. Ich danke Ihnen.
-
Joachim Gauck
Vor ziemlich genau zwei Monaten saß ich in einem Flüchtlingslager, in einem Zelt, es war in Kahramanmaras, an der türkisch-syrischen Grenze. Ich saß mit Vater, Mutter, Großvater zusammen, und die erzählten von dem Krieg, der sie vertrieben und zu Opfern von Terror gemacht hatte. Sie waren ängstlich, aber sie waren geborgen. Sie hatten vier Kinder. Das jüngste war dort im Lager geboren. Und jetzt warteten sie. // Ich frage mich manchmal, ob die Menschen, die ich dort getroffen habe, überlebt hätten, wenn sie über das Mittelmeer geflüchtet wären? Hätten die Kleinen es geschafft, wäre das Jüngste geboren worden, wer hätte überlebt, wären alle gestorben? // In Situationen wie diesen merkt jeder: Menschen zu begegnen, das ist etwas anderes, als nur Zahlen zu begegnen oder Statistiken. Man blickt in Gesichter - verstörte, verängstigte -, hört die dramatischen Geschichten, spürt die Hoffnung auf Hilfe aus der Ferne, aus der Fremde. Irgendwoher muss sie doch kommen. // Aber natürlich müssen sich Fachleute, die sich mit dem Thema Flüchtlinge befassen, auch über Statistiken beugen, müssen Zahlen kennen, sie verfolgen. Müssen erkennen, wie groß der Druck ist, der von diesem Teil der Weltbevölkerung ausgeht, die nicht beheimatet ist. Wenn wir Zahlen und Statistiken sehen, erkennen wir, was wir tun können, wo wir stehen. Also muss man auch ein paar Zahlen nennen. // Sie alle hier im Raum wissen: Bund und Länder haben beschlossen, weitere 10.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Das empfinde ich als richtig, wichtig und wertvoll. 5.400 Syrer haben dank der ersten beiden Kontingente auf gefahrlosem Wege Schutz in Deutschland gefunden. // Aber der Bürgerkrieg dauert nun schon seit 2011. Die Toten, kann keiner mehr zählen, von mehr als 150.000 ist die Rede. Und auch wenn kein anderer europäischer Staat mit vergleichbaren humanitären Programmen auf den dramatischen Konflikt reagiert hat, auch wenn die, die in Deutschland aufgenommen werden, bessere Bedingungen vorfinden als in den meisten anderen Ländern der Welt: Der überwiegende Teil der rund 32.000 Syrer, die seit Beginn der Gewalt nach Deutschland kamen, hat sich auf anderen Wegen durchschlagen müssen, auch auf dem illegalen und lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer. // Millionen sitzen in der Krisenregion fest, als Flüchtlinge im eigenen Land oder in Lagern in der Türkei und in Jordanien. Was dort geleistet wird, haben Daniela Schadt und ich mit eigenen Augen gesehen. Im Libanon leben derzeit mehr als eine Million Flüchtlinge. Das ist, gerechnet auf die Bevölkerung, als wären unter uns in Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge anwesend. // "Tun wir wirklich alles, was wir tun könnten?" Das habe ich immer wieder gefragt, auch in der Weihnachtsansprache habe ich das getan. Sie, liebe Gastgeber, zitieren es in der Ankündigung zu diesem Symposium. Zahlen und Statistiken geben auch hier einen Eindruck. // In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland insgesamt 54.956 Erstanträge auf Asyl gestellt - mehr als doppelt so viele wie im selben Zeitraum im vergangenen Jahr. In absoluten Zahlen kommen in kein anderes Land Europas mehr Asylbewerber. Gemessen an der Bevölkerungszahl aber liegt Deutschland in Europa längst nicht an der Spitze, sondern auf Platz 9, deutlich hinter Schweden, auch hinter Österreich, hinter Ungarn und Belgien. // Blicken wir nur auf uns selbst, dann neigen wir nicht selten zur Selbstgerechtigkeit. Ziehen wir aber auch in Betracht, wie viele andere dieselben oder ähnliche Probleme lösen, dann werden wir wohl zwangsläufig demütiger. // Wer macht sich bewusst, dass sogenannte Binnenflüchtlinge den absolut größten Teil der Flüchtlinge in der Welt ausmachen? Wer weiß schon, dass insgesamt nur ein kleiner Teil der weltweit mehr als 51 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen Schutz in Europa sucht - und ein noch kleinerer tatsächlich findet? Dass meistens die ärmsten Länder für die Armen aus ihrer Nachbarschaft aufkommen? Setzt man die Zahl der Flüchtlinge ins Verhältnis zur Wirtschaftskraft der Länder, so sind nach der aktuellen Statistik des UNHCR die drei größten Aufnahmeländer Pakistan, Äthiopien und Kenia. // "Tun wir alles, was wir tun könnten?" Eine Antwort liegt - nach den genannten Zahlen - nahe: Wir, das heißt Deutschland und auch Europa, tun viel. Aber nicht so viel, wie es selbst manchmal scheint. // Nun hat sich Politik leider nie allein am humanitär Gebotenen zu messen, sondern immer auch am politisch Machbaren. // Das ist ein Satz, der mir schwer über die Lippen geht. Ich möchte es eigentlich anders. Aber wir leben in einem Land, in dem wir es mit Menschen zu tun haben, die ihrerseits mit vielen Begrenzungen leben müssen. Und deshalb richtet Politik ihr Augenmerk eben immer auch auf das Machbare. In diesem Satz steckt so etwas wie eine doppelte Abgrenzung: Abgrenzung gegenüber denen, die wünschen, wir sollten unsere Tore weit aufmachen für alle Mühseligen und Beladenen. Aber auch gegenüber denen, die meinen, die Grenze des Machbaren sei doch längst erreicht und wir müssten uns noch viel besser abschotten als wir es bisher getan haben. // Flüchtlingspolitik wird immer eine schwierige Politik bleiben. Und ich sehe nirgendwo eine Patentlösung. Wir werden nie allen Bedrohten und Verfolgten Zuflucht und Zukunft bieten können. // Der Asylkompromiss von 1993 hat den dramatisch gestiegenen Antragszahlen damals nach dem Ende der Teilung Europas Rechnung getragen, allerdings auf eine bis heute umstrittene Weise. Und ich will nicht verhehlen, in mir klingt eine Feststellung von Burkhard Hirsch aus dem Jahr 2002 nach, die ich als Warnung empfinde: "Die Geschichte des Asylrechts ist auch eine Geschichte der Abwehr von Zuwanderung." // Vielleicht ist es diese Befürchtung, die mich vor einiger Zeit veranlasst hat zu sagen: Wir könnten mehr tun. Wir könnten manches besser tun. Wir müssten es tun in Achtung der Rechte, zu denen wir uns doch verpflichtet haben. Vor allem sollten wir es gemeinsam tun, als Europäer. // Viele Ältere von uns haben selbst noch erlebt, wie Europa ein Kontinent der Flüchtlinge und Vertriebenen war. Dieser Kontinent hat durch eine Geschichte von Gewalt und Kriegen zu den Werten gefunden, auf die wir heute unsere Gemeinschaft in Europa gründen: Menschenrechte und Demokratie, Solidarität und Offenheit - nicht Ängstlichkeit und Abwehr. // In der Flüchtlingspolitik stellt uns das vor ein Dilemma: Einerseits hat die Europäische Union ein legitimes Interesse daran, ihre Außengrenzen zu überwachen und sich vor unkontrollierter Zuwanderung zu schützen. Andererseits muss sie sich fragen lassen, inwieweit sie dadurch die Rechte oder sogar das Leben derer gefährdet, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung Schutz suchen. // Das Jahr ist nun gerade zur Hälfte herum - und schon jetzt sind mehr als 50.000 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeerraum angekommen, mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Darin spiegelt sich auch der bewaffnete Konflikt in Syrien, der zu den anderen, weiter bestehenden Krisenregionen hinzugekommen ist. Ein neuer Konflikt im Irak existiert, wir alle wissen es. // Die wachsende Zahl der Bootsflüchtlinge ist aber auch eine Reaktion auf die zunehmende Abschottung der südöstlichen Landgrenzen der Europäischen Union. Mehr und mehr Fluchtwillige suchen also den Weg, der lebensgefährlich ist, über das Mittelmeer. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten sind vermutlich rund 23.000 Menschen beim Fluchtversuch übers Meer umgekommen. Sie sind verdurstet, ertrunken oder gelten als vermisst. // Und kaum ein Tag vergeht, ohne dass von neuen Flüchtlingen die Rede ist. Auch der heutige nicht. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist heute Morgen eine Nachricht herumgegangen, die uns erschüttert hat: Wieder ist ein Boot mit 30 Toten vor der Küste Siziliens entdeckt worden. // Ich kann mich an solche Nachrichten nicht gewöhnen. Niemand in Europa sollte sich daran gewöhnen. Wir sind doch stolz darauf, dass zwei Dutzend Staaten - darunter solche, die über Jahrhunderte hinweg miteinander im Krieg lagen - ihre Grenzkontrollen untereinander abgeschafft und einen "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" geschaffen haben. Der europäische Gipfel von Tampere, auf dem 1999 über ein gemeinsames Asylsystem verhandelt wurde, war sich übrigens einig: "Es stünde im Widerspruch zu den Traditionen Europas, wenn diese Freiheit den Menschen verweigert würde, die wegen ihrer Lebensumstände aus berechtigten Gründen in unser Gebiet einreisen wollen." So heißt es dort. // Und nun die Bilder der Särge im Hangar des Flughafens von Lampedusa, die Bilder der kletternden Menschen am Stacheldrahtzaun der Exklaven Ceuta oder Melilla - sie passen doch nicht zu dem Bild, das wir Europäer von uns selber haben. // Was können, was müssen wir also tun? // Die Bundesrepublik hat bei ihrer Gründung einen fundamentalen Satz in ihre Verfassung geschrieben: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht" - ein damals noch ganz nahes und ganz uneingeschränktes Echo auf die Leidensgeschichten ungezählter Deutscher, die vor der nationalsozialistischen Diktatur fliehen mussten. Wir sollten uns an Hannah Arendt erinnern, die nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts von Staaten- und Schutzlosigkeit von Menschen das Recht, Rechte zu haben, einforderte. // Sowohl unsere Verfassung als auch die Genfer Flüchtlingskonvention halten uns dazu an, Menschen Zuflucht zu gewähren, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werden. Mögen sich die Gründe für die Flucht in den vergangenen Jahrzehnten auch verändert haben, so bleiben die Kernpunkte der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 bis heute gültig. // Für mich gilt daher: Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hat sicherzustellen, dass jeder Flüchtling von seinen Rechten auch Gebrauch machen kann - nicht zurückgewiesen zu werden ohne Anhörung der Fluchtgründe, gegebenenfalls auch Schutz vor Verfolgung zu erhalten. Auch die Hohe See ist kein rechtsfreier Raum, auch dort gelten die Menschenrechte. Dabei beziehe ich mich nicht zuletzt auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. // Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hat also nicht nur die europäischen Grenzen zu schützen, sondern auch Menschenleben an den Grenzen Europas. Solange Asylsuchende nur in Deklarationen, nicht aber in der Realität in allen Mitgliedsländern die gleichen Bedingungen von Schutz und Hilfe erleben, werden sich alle europäischen Regierungen fragen lassen müssen, was sie tun, um die Aufnahme-, Verfahrens- und Anerkennungsstandards auch tatsächlich in allen Ländern anzugleichen. // Und schließlich haben wir unter Europäern die entstehenden Lasten der Solidarität gerechter, transparenter und solidarischer zu teilen. Ich höre mit Interesse, dass Sie hier beim Symposium auch darüber debattieren werden, wie Lösungen aussehen könnten, die etwa Druck von den Grenzländern nehmen könnten und auch darüber, wie wir als Deutsche Teil einer fairen Lastenteilung sein können. // Eines sollten wir nicht tun: einander vorrechnen, was erst der andere tun muss, bevor wir uns selbst bewegen. Denn die Flüchtlinge, die an Italiens oder Maltas Küsten landen, sind nicht allein die Flüchtlinge Maltas oder Italiens. Es sind nicht allein die Flüchtlinge von Lampedusa. Es sind Flüchtlinge, die in unserem Europa Schutz suchen. Sie haben Rechte, die zu achten wir uns als Europäer gemeinsam verpflichtet haben. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung als Europäer, sie menschenwürdig zu behandeln. // Unser Land hat angefangen - etwa mit den Kontingenten für syrische Flüchtlinge -, auch auf die neuen Herausforderungen zu reagieren, als Teil unserer Verantwortung in der Welt. Die Bürgerkriegsflüchtlinge brauchen vor allem vorübergehenden Schutz, den wir ihnen mit humanitären Aufnahmeprogrammen bieten können. Die meisten von ihnen wollen doch zurück, wenn es nur irgend geht. // Jene Flüchtlinge aber, die nicht zurückkehren können, weil sie sonst verfolgt oder gar getötet würden, oder weil die Gewalt in ihrem Heimatland einfach nicht beendet ist, sie brauchen eine dauerhafte Lebensperspektive im Exil. Gut, dass Deutschland seit zwei Jahren in einem Resettlement-Programm besonders Schutzbedürftige aufnimmt. Wer mit Menschen spricht, die - oft nach quälenden Jahren der Ungewissheit - endlich ankommen können, der weiß, wie sehr man sich wünschen muss, noch mehr von ihnen würden diese Chance erhalten. Es ist gut, dass die Große Koalition bereit ist, das Resettlement-Programm auszubauen. Die Zahlen sprechen für sich: gesucht werden aktuell Plätze für 170.000 Flüchtlinge. Deutschland nimmt derzeit 300 pro Jahr auf, die gesamte EU ungefähr 5.000, dieUSA alleine hingegen mehr als 50.000. // Insgesamt geht es meines Erachtens darum, die Verfahren für die Flüchtlinge gerechter und effektiver zu gestalten. Schnellere Prüfungen, wie sie im Koalitionsvertrag verabredet wurden, bringen, wenn sie fair bleiben, allen Seiten schneller Klarheit. Zu einer effektiveren Flüchtlingspolitik gehört aber auch, dass wir diejenigen auf humane Weise zurückweisen, die nach den gültigen Kriterien keine Fluchtgründe haben, die zur Aufnahme, jedenfalls bei uns in der Bundesrepublik, berechtigen würden. Ich wünsche mir eine Solidarität, die wir auch leben können. // Es ist gut, dass sich in Bereichen, die lange umstritten waren, inzwischen etwas bewegt: bei der Lockerung der Residenzpflicht etwa oder beim Arbeitsverbot für Asylbewerber. Ich habe vor etlicher Zeit das Übergangswohnheim in Bad Belzig besucht. Und dort habe ich gesehen, dass viele, die dort untätig bleiben müssen, darunter leiden, sich nicht selbst ein besseres Leben erarbeiten zu können. Sie müssen einfach sitzen und warten. Das legt sich schwer auf ihr Gemüt. Die allermeisten von ihnen wollen doch keine Almosenempfänger sein. Gut also, wenn die Zeit des Arbeitsverbots gekürzt wird. Schwierig, wenn die bleibenden Beschränkungen weiterhin die Chance auf einen Arbeitsplatz erschweren. // Grundsätzlich sollten wir überlegen, wie mehr Durchlässigkeit zwischen den Zugangswegen "Asyl" und "Arbeitsmigration" geschaffen werden kann. Denn wer einmal vergeblich um Asyl gebeten hat, wird kaum noch durch ein anderes Tor Einlass finden, auch wenn er oder sie Qualifikationen hat, die hierzulande durchaus gebraucht werden. Viele der Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland geschafft haben, sind hochmobil, flexibel, mehrsprachig, leistungs- und risikobereit. // Wir wissen: Die Grenzen sind oft fließend zwischen politisch erzwungener, wirtschaftlich erzwungener oder tatsächlich freiwilliger Migration. Zwar können und wollen wir die Unterscheidung nicht aufgeben, wer schutzbedürftig ist und wer nicht. Das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar. Wohl aber sollten wir - im nationalen wie im europäischen Rahmen - versuchen, unterschiedliche Zuzugsmöglichkeiten vom Studium bis zum Familiennachzug zu gewährleisten. // Erlauben Sie mir eine kleine Abschweifung: Wir sind hier in der Französischen Friedrichstadtkirche, an einem Ort, der - wie auch viele Familiennamen in unserem Land - an eine der berühmtesten Flüchtlingsgruppen der Vergangenheit erinnert: an die Hugenotten. Unser Bundesminister des Inneren hat also einen - ich gebe zu: sehr weit zurückreichenden - Migrationshintergrund. Als seine Vorfahren in diese Gegend kamen, hatten sie eine lange Geschichte von Verfolgung, Bürgerkrieg und Duldungen hinter sich. Damals gab man den Neuankömmlingen die Möglichkeit, sich durch eigene Arbeit einen Platz in der neuen Heimat zu erarbeiten - durchaus zum Vorteil des Aufnahmelandes. Auch daran sollten wir denken in einer Gesellschaft, in der viel über den demografischen Wandel, Bevölkerungsrückgang und drohenden Fachkräftemangel diskutiert wird. // Migration, das haben Studien längst erwiesen, kann ein starker Entwicklungsmotor sein, übrigens auch für die Herkunftsländer. Oder, wie es der berühmte Ökonom John Kenneth Galbraith formulierte: "Migration ist die älteste Maßnahme gegen Armut". Darauf sollten wir bauen, im besten Fall zum allseitigen Nutzen: mit Programmen, die so gestaltet sind, dass sie sowohl den Migranten selbst helfen als auch den Gesellschaften, von denen sie aufgenommen werden - und auf längere Sicht auch den Gemeinschaften und Gesellschaften, die sie verlassen haben. Wir wissen inzwischen zum Beispiel, dass Migranten dreimal so viel Erspartes in ihre Herkunftsländer überweisen wie öffentliche Entwicklungsgelder fließen. Schwerer zu berechnen, aber nicht minder wichtig sind die Kenntnisse und nicht zuletzt die Werte, die sie in ihre Heimat bringen, wenn sie zurückkehren. // "Tun wir wirklich schon alles, was wir tun sollten?" Die Antwort auf diese Frage hängt nicht allein von finanziellen Ressourcen ab oder von politischen Programmen, sondern mindestens ebenso von der Art und Weise, wie ehrlich, pragmatisch und nüchtern die Politik und die Gesellschaft die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik diskutiert. Dabei würde deutlich, dass die Zahlen und Proportionen, die ich eingangs nannte, keineswegs so erschreckend sind, dass unsere Hilfsbereitschaft schon überfordert wäre. Solidarität ist zuerst und vor allem eine Grundlage unseres menschlichen Miteinanders und im Übrigen ist sie Kennzeichen unserer Demokratie. // Diejenigen, die kommen, sind Menschen, die oft Schlimmes erlebt und Unterstützung nötig haben. Ich bin den zivilgesellschaftlichen Organisationen dankbar, auch den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden, den Anwälten, all den Ehrenamtlichen, die sich seit vielen Jahren für humane Verbesserungen in der Asylpolitik einsetzen und sich immer wieder gegen diejenigen wenden, die gegen Zuwanderer hetzen oder gar Brandsätze auf Asylbewerberheime werfen. Bewundernswert ist auch das Engagement vieler Kommunen, der Bürgerinnen und Bürger für die ganz konkreten Bedürfnisse von Flüchtlingen. Viele Gemeinden begreifen diese nicht länger als lästige Gäste auf Zeit, sondern als Menschen, denen - egal, wie lange sie bleiben wollen - Brücken in unsere Gesellschaft gebaut werden müssen, weil das auch im Sinne unserer Gesellschaft ist. Es gibt ungezählte Initiativen, die auf die unterschiedlichste Weise Begegnungen fördern und damit auch das Verständnis für die Situation von Asylsuchenden. // Das macht Mut. Wir wollen doch offen sein und offen bleiben für den Wunsch von Menschen, frei zu sein so wie wir das wollen: frei zu sein von Verfolgung, von Gewalt, von Tod. Wir wollen doch dieser ihrer Sehnsucht folgen und wir können dennoch in unserer Politik geerdet bleiben. Mit Verständnis für die Gründe, die Menschen haben, ihre Heimat zu verlassen. Mit Rücksicht, auch auf die Grenzen der Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft. Aber vor allem mit Weitsicht bezüglich der Chancen von Zuwanderung. Wir müssen es sehen wollen. Und wir sehen all dies im Bewusstsein unserer gemeinsamen Verantwortung als Europäer. // Wir wissen: Es wird nie möglich sein, genug zu tun. Aber wenn wir das uns Mögliche nicht tun, versagen wir nicht nur vor unserem Nächsten, sondern wir verlieren auch die Neigung zu uns selbst, unsere Selbstachtung.
-
Joachim Gauck
Was für ein schöner Sonntag! // Es war der 18. März, heute vor genau 22 Jahren, und wir hatten gewählt. Wir, das waren Millionen Ostdeutsche, die nach 56-jähriger Herrschaft von Diktatoren endlich Bürger sein durften. // Zum ersten Mal in meinem Leben, im Alter von 50 Jahren, durfte ich in freier, gleicher und geheimer Wahl bestimmen, wer künftig regieren solle. Die Menschen, die damals zur Wahl strömten, lebten noch im Nachhall der friedlichen Revolution, als wir das Volk waren und dann die Mauern fielen. // Ich selber hatte als Sprecher des Neuen Forums in Rostock daran mitwirken dürfen. Wir waren schon frei von Unterdrückung. Jetzt schickten wir uns an, Freiheit zu etwas und für etwas zu erlernen. Nie werde ich diese Wahl vergessen, niemals, weder die über 90 Prozent Wahlbeteiligung noch meine eigene innere Bewegung. Ich wusste: Diese meine Heimatstadt und dieses graue, gedemütigte Land, wir würden jetzt Europa sein. In jenem Moment war da neben der Freude ein sicheres Wissen in mir: Ich werde niemals, niemals eine Wahl versäumen. // Ich hatte einfach zu lange auf das Glück der Mitwirkung warten müssen, als dass ich die Ohnmacht der Untertanen je vergessen könnte. // "Ich wünschte, ein Bürger zu sein. Nichts weiter. Aber auch nichts weniger als das." So hatte ein deutscher Demokratielehrer - es war Dolf Sternberger - seine politische Haltung einmal definiert. // Ich habe am 18. März 1990 genau denselben Wunsch gespürt. Ich habe damals gefühlsmäßig bejaht, was ich mir erst später theoretisch erarbeitet habe: dass aus dem Glück der Befreiung die Pflicht, aber auch das Glück der Verantwortung erwachsen muss und dass wir Freiheit in der Tiefe erst verstehen, wenn wir ebendies bejaht und ins Leben umgesetzt haben. // Heute nun haben Sie, die Wahlfrauen und -männer, einen Präsidenten gewählt, der sich selbst nicht denken kann ohne diese Freiheit und der sich sein Land nicht vorstellen mag und kann ohne die Praxis der Verantwortung. Ich nehme diesen Auftrag an: mit der unendlichen Dankbarkeit einer Person, die nach den langen Irrwegen durch politische Wüsten des 20. Jahrhunderts endlich und unerwartet Heimat wiedergefunden hat und die in den letzten 20 Jahren das Glück der Mitgestaltung einer demokratischen Gesellschaft erfahren durfte. Deshalb: Was für ein schöner Sonntag dieser 18. März auch für mich! // Ermutigend und beglückend ist es für mich auch, zu sehen, wie viele im Land sich in der letzten Zeit eingebracht haben und mich ermutigt haben, diese Kandidatur anzunehmen. Es sind Menschen ganz unterschiedlicher Generationen und Professionen; Menschen, die schon lange, und Menschen, die erst seit kurzem in diesem Land leben. Das gibt mir Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den Regierenden und der Bevölkerung, an der ich nach meinen Möglichkeiten unbedingt mitwirken werde. // Ganz sicher werde ich nicht alle Erwartungen, die an meine Person und an meine Präsidentschaft gerichtet wurden, erfüllen können. Aber eins kann ich versprechen: dass ich mit all meinen Kräften und mit meinem Herzen Ja sage zu der Verantwortung, die Sie mir heute übertragen haben; denn was ich als Bürger anderen Menschen als Pflicht und als Verheißung beschreibe, muss selbstverständlich auch Gültigkeit für mich als Bundespräsidenten haben. Das heißt auch, dass ich mich neu auf Themen, Probleme und Personen einlassen werde, auf eine Auseinandersetzung mit Fragen, die uns heute in Europa und in der Welt bewegen. // Ich danke Ihnen, den Mitgliedern der Bundesversammlung, für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Sie, die Sie hier gewählt haben, sind ja nicht nur Deputierte, sondern Sie sind auch - das ist mir voll bewusst - Vertreter einer lebendigen Bürgergesellschaft. Ob wir also als Wahlbevölkerung am Fundament der Demokratie mitbauen oder ob wir als Gewählte Weg und Ziel bestimmen: Es ist unser Land, in dem wir Verantwortung übernehmen, wie es auch unser Land ist, wenn wir die Verantwortung scheuen. // Bedenken sollten wir dabei: Derjenige, der gestaltet, wie derjenige, der abseits steht, beide haben sie Kinder. Ihnen werden wir dieses Land übergeben. Es ist der Mühe wert, es unseren Kindern so anzuvertrauen, dass auch sie zu diesem Land "unser Land" sagen können.
-
Joachim Gauck
Wenn der Bundespräsident den Deutschen Bankentag eröffnet, im siebten Jahr nach dem Ausbruch der weltweiten Finanz- und Schuldenkrise, dann steht er ganz unterschiedlichen Erwartungen gegenüber. Viele Bürger wünschen sich, dass den Banken wieder einmal die Leviten gelesen werden, dass noch einmal abgerechnet wird mit Gier, Größenwahn, Fehlverhalten und Kontrollverlust. Viele Bankmanager, vielleicht auch manche von Ihnen hier im Saal, wünschen sich dagegen eine Würdigung der Reformen, auch einer neuen Geschäftskultur, um die sich die Politik und die Branche jeweils bemühen. // Beide Erwartungen sind selbstverständlich. // Es stimmt ja: Einige Banken und einige Mitarbeiter haben sich eine Menge zu Schulden kommen lassen. Die Justiz ermittelt noch immer in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf Untreue, Bilanzfälschung oder Marktmanipulation. Und erst vor wenigen Tagen wurden weitere Vorwürfe öffentlich: Die Finanzbehörden untersuchen, ob durch einige besonders trickreiche Anlagemodelle der Banken und der Geldanlagefonds Steuern in Milliardenhöhe hinterzogen wurden. Auch dort, wo nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde, war manches Geschäft ethisch fragwürdig, manches Risiko auch unvertretbar hoch. Falsche Anreize im Bonussystem, übersteigerte Gewinnansprüche, verantwortungsloses Verhalten zu Lasten Dritter - da war viel fehlgeleitete Kreativität im Spiel. // Hinzu kamen Mängel in der staatlichen Aufsicht und Regulierung, eine Politik des billigen Geldes und eine hohe Verschuldung bei Staaten, Unternehmen und Bürgern. Das alles trug dazu bei, dass die Stabilität des ohnehin extrem komplexen Finanzsystems unterminiert wurde. Einzelne Banken mussten, weil too big to fail, von der Politik gerettet werden, natürlich auf Kosten der Steuerzahler. So wurde ein zentrales Prinzip der Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt: Wer Risiken eingeht, muss für Verluste haften. // Das alles ist oft und völlig zu Recht kritisiert worden - auch ich habe mich gelegentlich kritisch dazu geäußert. // Andererseits ist aber auch richtig: Es hat sich inzwischen viel getan. Banken müssen heute mehr Eigenkapital vorhalten als vor der Krise. Neue Regeln sollen riskante Geschäfte kontrollierbarer, durchschaubarer machen. Mit Stresstests wird die Überlebensfähigkeit der Banken im Krisenfall überprüft. Und nicht zuletzt haben viele Institute Fehler eingestanden, sie haben neue Geschäftsmodelle entwickelt und sie haben sich ethischen Fragen gestellt. Kein Zweifel: Die Branche befindet sich im Wandel. // Ein Zwischenfazit fast sieben Jahre nach Beginn der Krise fällt also gemischt aus: Fehler sind erkannt, politische und unternehmerische Reformen auf dem Weg. Dieser Prozess ist in vollem Gang, aber er ist noch lange nicht abgeschlossen. // So will ich heute weder Bankenbeschimpfung betreiben noch kann ich eine heile Bankenwelt besingen. // Vielmehr möchte ich einen Schritt zurücktreten und mit etwas Grundlegendem beginnen: Ich möchte über Geld sprechen. // Nun wird mancher denken: nicht die originellste Idee auf einem Deutschen Bankentag. Aber ganz so naheliegend ist das Thema eben doch nicht. Denn es ist in unserer Gesellschaft ja keineswegs selbstverständlich, über Geld zu sprechen. Ganz im Gegenteil, es heißt doch oft: Über Geld spricht man nicht! Das gilt als anstößig, als unmanierlich. Es mag im Privatleben durchaus Gründe für diese Meinung geben. Im öffentlichen Leben aber, in der Sozialen Marktwirtschaft, wäre eine solche Haltung fatal. So, als ob sich die Bürger in unserer Demokratie auf die Maxime einigten: "Über Politik spricht man nicht!" // Geld verleiht Einfluss, aber es erzeugt auch Abhängigkeiten. Man kann es verdienen, sparen und anlegen - und dann darauf vertrauen, dass andere es vermehren. Man kann es sich leihen und muss es anschließend zurückzahlen. Banken sind Mittler zwischen Schuldnern und Gläubigern, und sie selbst sind beides: Schuldner und Gläubiger. Geld und Kredit, Forderungen und Verbindlichkeiten erzeugen Abhängigkeiten. Und wo Abhängigkeiten entstehen, da wird auch Macht ausgeübt. // Welche Macht heute von Banken und Finanzmärkten ausgeht, lässt eine einzige Zahl erahnen: 30 Billionen Euro - das ist die Summe der Bankbilanzen im Euroraum. Seit der Finanzkrise hat sich der Wert der weltweit zirkulierenden Schuldtitel noch einmal erhöht. Noch nie gab es so viele Schulden, und noch nie gab es so viel Vermögen wie heute. Nie war also die Rolle der Vermittler zwischen Gläubigern und Schuldnern wichtiger. // Die Finanz- und Schuldenkrise hat uns vor Augen geführt, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Akteure versagen und die Kontrolle lückenhaft ist oder gar ausbleibt. Gerade weil die Wirkungsmacht der Finanzwirtschaft so groß ist und so weit in die Lebenswirklichkeit der Menschen hineinreicht, gerade deshalb ist unser Wirtschaftssystem zwingend darauf angewiesen, dass alle Akteure informiert und verantwortungsbewusst handeln. Alle Akteure, was heißt das? Für mich erstens: die Banken, also ihre Mitarbeiter und Manager. Zweitens die Bürger, die als Anleger nicht nur nach Renditeverheißungen schielen dürfen, sondern auch nach dem Risiko fragen sollten, das ihnen allerdings nicht verborgen bleiben darf. Und drittens die Politik, die vor der Herausforderung steht, die Marktordnung fortzuentwickeln und kluge Regeln zu formulieren, die helfen, die Kräfte des Marktes freizusetzen und gleichzeitig Missbrauch zu verhindern. // Lassen Sie mich mit der besonderen Verantwortung der Banken beginnen. // Es lohnt sich, einen Blick auf die Geschichte Europas zu werfen, um zu verstehen, welche Rolle Banken und Geldwirtschaft beim Weg in die Neuzeit spielten. Damals, als Markt- und Münzrechte verliehen wurden, als die Städte aufblühten, als das Geldwesen sich ausbreitete und das Bankenwesen entstand, da löste sich Europa aus dem Mittelalter. Der Raum des Handels und Austausches wuchs. Und das war gut für die Bürger der damaligen Zeit. Und als sich das Bürgertum im 19. Jahrhundert zunehmend emanzipierte, da öffnete sich das Bankwesen für Handwerker, Kleinunternehmer und Bauern - und für ihre Ideen. Zur gleichen Zeit entstanden damals die Genossenschaftsbanken, die vom Gedanken der gemeinschaftlichen Selbsthilfe geprägt waren. Diese Bankenwelt, die aus großen Universalbanken und Spezialinstituten, aus Sparkassen und Privatbanken besteht, sie ist heute ein Spiegel der deutschen Wirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt - vom Mittelstand bis zu den international aktiven Großunternehmen. // Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, dass es sich lohnt, an diesem Neben- und Miteinander von Privat- und Genossenschaftsbanken sowie öffentlich-rechtlichen Sparkassen festzuhalten! So viel muss sein auf einem Bankentag. // Heute ist fast jeder Bundesbürger ein Bankkunde, dem Girokonto, Sparbuch, Kreditkarte, Privatdarlehen und manchmal auch ein Wertpapierdepot zur Verfügung stehen. Weil so viele Menschen so einfach so viele Finanzprodukte kaufen können - übrigens durchaus ermutigt von der Politik -, weil in der Branche so vieles neu, schnell und unübersichtlich ist, wächst ihren Managern und Mitarbeitern eine besondere Verantwortung zu - für ihre Kunden und für das Funktionieren unserer Sozialen Marktwirtschaft und damit letztlich für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Staat und Gesellschaft. // Worauf kommt es also an? Auch wenn es ein wenig altmodisch klingt: Mitarbeiter von Banken dürfen sich durchaus am Ideal des ehrbaren Bankiers orientieren, gerade in Zeiten, da die Geschäfte so komplex sind wie nie zuvor. Sie müssen durch Seriosität und Sachkenntnis überzeugen, müssen ihr Handeln erklären können, Chancen und Risiken offenlegen. Und zwar nicht nur im Kleingedruckten, sondern im Klartext. Nicht nur zur eigenen rechtlichen Absicherung, sondern zur bestmöglichen Aufklärung der Kunden. So wird vermieden, dass sich das Risiko, für das sich ein Kunde bewusst entscheidet, in eine Gefahr verwandelt, der er hilflos ausgeliefert ist. // Meine Damen und Herren, an diesem Punkt sehe ich Sie in der Bringschuld! // Ich weiß sehr wohl: Die meisten Akteure des Bankgewerbes in unserem Land halten sich an diese Regeln. Sie haben nichts gemein mit dem Finanzjongleur, der in manchem Hollywoodfilm eine Hauptrolle spielt, sondern sie vergeben Firmen- und Hypothekenkredite, informieren über Spareinlagen und Altersvorsorge - und leisten dabei gute Arbeit. Sie tragen bei zu Wachstum und Dynamik, Beschäftigung und Innovation. // Vertrauen zu erwerben und zu erhalten liegt im eigenen Interesse der Banken. Denn sonst entziehen sie sich selbst und dem Markt die Geschäftsgrundlage. Nichts illustriert dies besser als der Zusammenbruch des Geldmarktes zu Beginn der Finanzkrise, damals haben sich nicht einmal die Banken untereinander vertraut. // Damals zeigte sich, was ich einmal die "Fratze der ungezügelten Freiheit" genannt habe. Es ist die Freiheit, man könnte sagen, der Pubertierenden, die sich nur als Freiheit von etwas definiert, von Regeln, von Zwängen, und die zu wenig nach den Folgen des eigenen Handelns fragt. Dagegen ist die "Freiheit, die ich meine", und nach der wir gemeinsam streben sollten, eine Freiheit zu etwas, zu Gestaltung und Mitgestaltung. Es ist Freiheit in Verantwortung, die die Bindungen und Beziehungen zu anderen Menschen und zum Gemeinwesen respektiert und fördert. // Das ist die Freiheit der Sozialen Marktwirtschaft - nicht der grenzenlose Übermut. Diese Freiheit steht für eine Kultur der Verantwortung, die über den Bilanzgewinn hinausgeht. In unserer Wirtschaftsordnung können Privatleute und Unternehmer gutes Geld verdienen, und sie sollen es sogar. Gewinnstreben ist keinesfalls verwerflich, sondern Voraussetzung für Investitionen und Innovationen. Und wer Geschäfte macht, geht auch immer das Risiko ein zu scheitern. Zur Verantwortung aber gehört es, Verluste dann auch selbst zu tragen. Wer besonders hohe Risiken eingeht, weil er weiß, dass im Notfall ein anderer die Kosten schultern wird, der handelt diesem Prinzip zuwider. // Die Abkehr von Tugenden der Sozialen Marktwirtschaft hat das Vertrauen der Bürger in die Banken erschüttert. Und, ehrlich gesagt: Angesichts mancher Exzesse verstehe ich das auch. Zugleich habe ich den Eindruck, dass auch die Kritik an diesen Zuständen manchmal das Kind mit dem Bade ausschüttet. Sie schlägt bisweilen um in eine ganz allgemeine Skepsis gegenüber der Marktwirtschaft. Da werden Wettbewerb und Freiheit für das Problem gehalten, und nicht deren Missbrauch. Das halte ich für fatal, denn Soziale Marktwirtschaft braucht informierte Bürger, die selbstbewusst am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt angelangt, bei der Rolle der Bürger. // Henry Ford, dem amerikanischen Industriellen, wird folgende Feststellung zugeschrieben: "Es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh." In einem Punkt muss ich da widersprechen: Es ist ganz und gar nicht gut, wenn Bürger einen wichtigen Wirtschaftssektor nicht hinreichend verstehen oder verstehen können. Es ist nicht gut, wenn es vielen schwerfallen muss, Sachverhalte zu durchdringen, weil ganze Teilbereiche der Gesellschaft auf kaum durchschaubare Art miteinander verflochten sind. Selbst Experten haben nach eigenem Bekunden oft nicht nachvollziehen können, was auf den Finanzmärkten tatsächlich vor sich ging. // Banken, ich habe es eben erwähnt, haben hier eine Bringschuld. Aber der Bürger, er hat durchaus auch eine Holschuld. Wer die Quellen unseres Wohlstands verstehen, wer persönliche Chancen nutzen und Risiken einschätzen will, der muss sich informieren und in Finanzfragen kompetenter werden. Er darf sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen, dass man über Geld nicht spricht. // Zum informierten Bürger gehört doch eigentlich eine ökonomische Grundbildung. Studien belegen, dass viele Deutsche hier Nachholbedarf haben. Ich weiß, dass einiges getan wird, um ökonomisches Wissen kreativ zu vermitteln. Da gibt es Beispiele, bei denen junge Menschen in der Schule schon eigene Firmen gründen oder an der Börse handeln. Sie lernen dabei wie Unternehmer zu agieren, von der Produktentwicklung bis hin zu Marketing und Vertrieb. Auch der Bankenverband leistet auf diesem Gebiet einen guten Beitrag. Trotzdem, ich frage mich: Wird die ökonomische Bildung in unseren Schulen und Berufsschulen ausreichend berücksichtigt? Hat das Wissen über ökonomische Zusammenhänge den gleichen Rang, den die Ökonomie heute für unser Leben und Wirtschaften hat? // Das ist nicht nur wichtig, damit der Einzelne gute Entscheidungen für sich selbst treffen kann. Wie durch politische Bildung Urteilsfähigkeit und Engagement junger Mitbürger gefördert werden kann, so ist auch die Fähigkeit wichtig, wirtschaftspolitische Debatten zu verfolgen, sich dort ein eigenes Urteil zu bilden und sich selbst an den Debatten zu beteiligen. Das gehört elementar zur Demokratie. Deren Schlüsselfigur ist doch der vielzitierte "mündige Bürger". Und der ist auch gefragt, wenn es um die Gestaltung unserer Wirtschaftsordnung geht. Nicht nur politische, auch ökonomische Apathie und Unwissenheit sind gefährlich. // Wie wichtig die Fähigkeit zum öffentlichen Gespräch über wirtschaftliche Fragen ist, das zeigt sich gerade dann, wenn es darum geht, die Konsequenzen aus der Krise zu ziehen. Also: welche Regeln brauchen Banken, welche Grenzen die Märkte? Welche Rolle spielt die Geldpolitik, welche Macht darf sie ausüben? Und wie finden wir den Weg aus der hohen Staatsverschuldung? // Dabei reicht es nicht aus, individuelles und unternehmerisches Handeln in den Blick zu nehmen und nur auf die Veränderung von Mentalitäten und Geschäftsmodellen zu setzen. Das alles ist richtig. Aber es war auch die staatliche Rahmenordnung, die Fehlverhalten ermöglicht und oft auch begünstigt hat. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. // Seit dem G20-Gipfel vor fünf Jahren in Washington wird daran gearbeitet, Banken stärker in Haftung zu nehmen und Regeln zu setzen, um Krisen weniger wahrscheinlich zu machen. Wir Europäer schaffen mit der Bankenunion eine einheitliche Aufsicht im Euroraum und neue Verfahren, um Eigner und Gläubiger in Haftung zu nehmen, wenn Banken ins Schlingern geraten. Damit kann es uns in Europa gelingen, Marktwirtschaft und Währungsunion zu stärken. // Es würde uns guttun, wenn solche wichtigen Fragen nicht allein von kau Fachpolitikern und Experten diskutiert würden, sondern stärker als bisher auch von Bürgern und Medien. Denn es wird weiter um das Ausmaß der Regulierung gerungen werden, gerungen werden müssen. Wir müssen uns fragen: Wurde wirklich schon genug getan, um das Finanzsystem krisenfester zu machen und Exzesse zu vermeiden? Oder geht manche Regel gerade für kleine Banken, die nicht "systemrelevant" sind und mit anderen Banken verflochten sind, vielleicht schon zu weit? // Dazu kann es durchaus unterschiedliche Antworten geben. Eine, die mir persönlich sehr sympathisch ist, stammt von Karl Popper, dem Begründer des Kritischen Rationalismus. Er hat einmal gefordert, den freien Markt nicht als "ideologisches Prinzip" zu betrachten, sondern einfach als eine Ordnung, die davon lebt, dass die Freiheit nur dort zu beschränken ist, wo es aus wichtigen Gründen notwendig ist. Er war sich bewusst, dass oftmals umstritten sein wird, wo genau die Grenze des Notwendigen verläuft. Das wird auch so bleiben. // Diese Grenze in kluger und verantwortungsvoller Weise zu ziehen, das ist Aufgabe der Politik. Sie gibt den Rahmen vor. Mindestens genauso wichtig ist es dann aber, wie Banken und Bürger diesen Rahmen füllen. Lassen Sie uns also weiter diskutieren, wie verantwortungsvolles Handeln von Banken und Bürgern zu stärken wäre. Lassen Sie uns über notwendige Grenzen und die Grenze des Notwendigen auf den Finanzmärkten diskutieren! In diesem Sinne also: Lassen Sie uns über Geld reden.
-
Joachim Gauck
Wer Sie würdigen möchte, hat es eigentlich leicht. Denn Ihr beruflicher Lebensweg ist derartig abwechslungsreich und spannend, dass man nur die einzelnen Stationen aufzuzählen hätte und eine Laudatio hielte sich gewissermaßen von selber. // Aber wer von Roman Herzog spricht, der hat natürlich zuallererst den Bundespräsidenten Roman Herzog vor Augen. Und die Erinnerung an diese fünf Jahre lässt naturgemäß die anderen Stationen des Berufslebens etwas in den Hintergrund rücken. Das Stichwort für ihre Amtszeit haben Sie bei Ihrem allerersten Auftritt schon selber gegeben, als Sie davon sprachen, Sie wollten unser Land" unverkrampft" repräsentieren. Um diesen Begriff gab es zunächst ein wenig Aufregung, da einige schon vermuteten, damit solle etwa ein verharmlosender Umgang mit der deutschen Geschichte gemeint sein. // Das war aber nicht der Fall. Sie zeigten es schon sehr bald mit jenen entschiedenen und unzweideutigen Reden, die Sie zum Gedenken an Krieg und Holocaust kurz nacheinander in Bergen-Belsen, Dresden und zum 8. Mai hielten. Hier wurde jedem klar, dass Sie nicht nur mit einer unmissverständlichen Haltung zur Vergangenheit die Köpfe und Herzen zu bewegen vermochten, sondern auch mit Lehren für die deutsche Gegenwart und Zukunft. // Auf Ihre Initiative und Ihre Entscheidung geht es auch zurück, dass wir den 27. Januar als den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begehen. Sie haben ihn proklamiert und haben gleich zwei Mal zu diesem Anlass vor dem Deutschen Bundestag gesprochen: "Wenn wir den Anfängen wehren wollen", so sagten Sie, "müssen wir unablässig wachsam sein." // Dass "unverkrampft" in diesem Zusammenhang ein besonders faires und gerechtes, aber auch ein entschiedenes Urteil ohne falsche Rücksichten meint, zeigte sich in einer anderen wichtigen Rede, die Sie uns Deutschen mit auf den Weg gegeben haben. Sie nahmen Stellung zur damaligen Debatte um Martin Walser und Ignatz Bubis. Sie bedankten sich zugleich bei beiden Kontrahenten, weil beide notwendige Fragen zur "Zukunft der Erinnerung" gestellt hatten. // Das scheint mir typisch für Sie zu sein: Bei aller Belesenheit, bei aller Hinwendung zur Geschichte, ging es Ihnen doch in erster Linie um die Zukunft unseres Landes und unserer Gesellschaft. Sie haben darüber nicht nur gesprochen, sondern dadurch dafür gesorgt, dass es seit Ihrer Amtszeit den "Deutschen Zukunftspreis" gibt. Ihr Interesse an Innovationen war stark und wirkte motivierend auf andere. Jedenfalls fanden sich genügend Mitstreiter, um den Preis auszuloben. Inzwischen haben die meisten wohl den Eindruck, den Deutschen Zukunftspreis gebe es schon immer. // So haben Sie mit dem Gedenktag des 27. Januar und mit dem Deutschen Zukunftspreis als Bundespräsident zwei bleibende Einrichtungen ins Leben gerufen, die eine die Vergangenheit, die andere die Zukunft betreffend. // Es gibt aber ein Wort - ein Stichwort -, das wie kein zweites mit Ihnen verbunden wird, nämlich den "Ruck". Es würde zu weit führen, all jene Debatten und Wortmeldungen zu rekapitulieren, die mit Ihrer sogenannten "Ruck-Rede" verbunden sind. // Ich will nur noch einmal daran erinnern, mit welch unerschrockenem Elan und tatsächlich unverkrampfter Direktheit Sie sich damals so ziemlich alle Gruppen und Grüppchen des Landes vorgeknöpft hatten, um allen, wirklich allen Mut und Lust zur Veränderung zu machen - Mut und Lust, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. // Eine der Wirkungen dieser Rede ist nun für uns Nachfolger im Amt die mit voraussagbarer Sicherheit immer wieder aufkommende Frage von Journalisten, ob diese oder jene Rede des Bundespräsidenten denn nun seine "Ruck-Rede" gewesen sei oder wann seine "Ruck-Rede" denn nun endlich komme. So haben Sie mit einem der kürzesten deutschen Wörter einen wirklich langen Schatten geworfen. // Ich sprach gerade von Ihrer Ermutigung, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Das ist, wenn ich es richtig sehe, überhaupt eine Ihrer intellektuellen Lieblingsbeschäftigungen: nämlich Ihre Zuhörer durch überraschende Ideenverknüpfung und so-noch-nicht-Gedachtes zu verblüffen. Verblüffung aber nicht als Selbstzweck des Neunmalklugen, sondern als Anstoß, sich wenigstens gedanklich, gern aber auch politisch-praktisch auf Neuland zu begeben. // Gerade weil Ihnen intellektuelle Trägheit immer ein Gräuel war und ist, sind Sie zwar Mitglied einer Partei geworden, aber Ihr Denken ließ sich nicht von Parteitagsbeschlüssen leiten. Und wer glaubte, dass Sie im Bundesverfassungsgericht nun einfach die sogenannte konservative Fraktion starkmachten, der sah sich durch manches Urteil, an dem Sie beteiligt waren, zum Beispiel jenes zur Demonstrationsfreiheit in Brokdorf, eines anderen belehrt. Aber vielleicht ist das auch Ihr Begriff von Konservativismus: im Zweifel für die Freiheit - und im Zweifel nicht für die felsenfeste Überzeugung, sondern für das bessere Argument. // Dass Sie Ihre bundespräsidialen Reden zur Kultur unter dem Titel "Freiheit des Geistes" herausgegeben haben, spricht für sich. Und es passt zu ihrer unruhigen und unbequemen Art, wenn sie dort "den Mut, echte Fragen zu stellen" fordern und Geduld anmahnen, wenn es nicht sofort eine Antwort gibt: "Wo keine Fragen gestellt werden", so sagen Sie, "wird nichts wirklich Neues entstehen, da erstarren die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wer auf Fragen verzichtet, der hat im Grunde auch auf neue Lösungen schon verzichtet." // In der Tradition des "echten Fragens" scheint mir auch das Institut zu stehen, das Ihren Namen trägt, das Roman Herzog Institut. Es versteht sich selbst als "Plattform für freies Nach-, Vor- und Querdenken." // Freies Denken in alle Richtungen: Das haben Sie in Ihren politischen Ämtern geübt, aber Sie waren lebenslang weit mehr als ein unverbindlicher Ideenschmied. Sie haben als Universitätsprofessor geforscht und gelehrt, als Minister der Exekutive angehört und als Richter und Präsident des Bundesverfassungsgerichts der Jurisdiktion. Erst dann, sozusagen nach dem akademischen und politischen Schwarzbrot - und nachdem Sie das Amt des Bundespräsidenten im Grundgesetzkommentar sorgfältig bedacht und beschrieben hatten - konnten Sie im Amt des Bundespräsidenten laut denken und frei reden. // Vieles wäre noch zu sagen, zum Beispiel zu Ihrem tatkräftigen Engagement für Europa im Verfassungskonvent, oder auch zu Ihrem jüngsten Appell, Europa neu zu denken, auch zu Ihren von tiefer Sorge getragenen Ausführungen zu Demokratie und Demoskopie. Aber wir wollen ja noch ein bisschen miteinander reden und miteinander essen und trinken. // Deswegen will ich ganz zum Schluss noch sagen: Was mich und viele andere immer sehr beeindruckt hat, das ist Ihre Gabe, auch sich selbst auf den Arm zu nehmen. Mir hat man erzählt, Sie hätten einmal auf die Frage, ob Sie sich erklären könnten, warum Sie bei den Leuten so gut ankämen, geantwortet, Sie könnten sich leider nicht von Ihrem bayrischen Dialekt befreien, und darum hätten die Zuhörer, sobald Sie den Mund aufmachten, schon das Gefühl, sie seien im Urlaub und bekämen deswegen umgehend gute Laune. Das ist nicht nur unverkrampft, das ist - verzeihen Sie: cool. // Unendlich viele Menschen in Deutschland denken gern und dankbar an Ihre Präsidentschaft zurück. Ich gehöre zu ihnen, so wie Sie, meine Damen und Herren, die Sie unserem Ehrengast freundschaftlich verbunden sind. Deshalb erheben wir voller Freude unser Glas auf Bundespräsident Roman Herzog.
-
Joachim Gauck
Wir feiern heute Abend eine der schönsten Transformationsgeschichten, die unser Land zu erzählen hat. Das Deutschlandradio ist ja nicht nur ein "Kind der Einheit", sondern es ist noch viel mehr. Gewiss ist dieser Sender - mit seinen heute drei Programmen - vor allem ein Produkt der Einheit. Aber gleichzeitig war und ist er aber auch ein Motor der Einheit. Er hat die Überwindung der Teilung begleitet, reflektiert und kommentiert. Und schließlich war das Deutschlandradio auch ein Labor der Einheit. Wie in nur wenigen anderen Institutionen haben hier Menschen mit Ost- und Westbiografien - ganz unterschiedlichen Ost- und Westbiografien übrigens - zusammen etwas Neues geschaffen. // Heute spiegelt das Deutschlandradio mit seinen Hörfunkprogrammen unser geeintes Deutschland in einem größer gewordenen Europa, in einer Welt, die sich beständig verändert. Darum bin ich gern zu Ihnen gekommen! // Es war keine leichte Geburt, damals, vor 20 Jahren. Es waren heikle Fragen zu klären. Etwa: Was soll mit dem Erbe der Hörfunksender der DDR geschehen, die als Instrumente sozialistischer Propaganda diskreditiert waren? Oder: Was tun mit RIAS und Deutschlandfunk, die mit der Vereinigung unseres Landes ihre ursprüngliche Bestimmung verloren hatten? Oder: Wie verfahren mit den Klangkörpern der Sender, das Bläserensemble des DSO haben wir gerade gehört. Die Konflikte von damals kennen viele von Ihnen natürlich weit besser als ich - Sie waren dabei. Ich will das auch nicht alles im Einzelnen nachzeichnen, das kann ich gar nicht, nur so viel will ich andeuten: Es gab auch mächtig Streit unter den Hebammen, jede hätte das Kind gern allein auf die Welt begleitet. // Am Ende stand eine bis heute einzigartige Konstruktion, die unseren Ehrengästen aus dem Ausland, von BBC und Radio France, vermutlich merkwürdig erscheint: Die ARD, das ZDF und alle 16 Bundesländer wurden per Staatsvertrag gemeinsam Träger von zwei Hörfunksendern unter einem Dach, mit Programmauftrag für ganz Deutschland. // Mindestens ebenso bemerkenswert wie das Kind aber waren die Eltern: Es gab ja deren gleich drei - und jedes Elternteil stand seinerseits für ein Stück deutscher Zeitgeschichte. // Dem Deutschlandfunk bin ich bis heute - wie übrigens viele aus dem Osten - von Herzen dankbar. Er war die bundesdeutsche Antwort auf den Deutschlandsender der DDR und hat - wie wenige andere Institutionen - die Verbindung zwischen Ost und West gehalten, als manche Landsleute im Westen schon nichts mehr über die DDR hören wollten. Der Deutschlandfunk folgte diesem Zeitgeist nicht. "Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden" - diesem Auftrag aus der Präambel des Grundgesetzes fühlte er sich stets verpflichtet. Zugleich aber hat er auch den Blick nach Europa und in die Welt geweitet. // Der Deutschlandfunk sei "Frequenz gewordene Zuverlässigkeit", schrieb die "taz" vor zwei Jahren zum 50. Geburtstag, "so etwas wie der Bundespräsident unter den Radiosendern: politisch engagiert, aber neutral und auf die großen Zusammenhänge bedacht". Das will ich nun nicht kommentieren, nur so viel: In ganz Deutschland - übrigens gerade auch in jenen Regionen, die früher in der DDR als "Tal der Ahnungslosen" bezeichnet wurden - danken es die Hörerinnen und Hörer bis heute mit großer Treue. // Auch der RIAS spielt in meinen Erinnerungen eine wichtige Rolle, eine frühe sogar. Denn damals habe ich dort Ernst Reuter gehört, als Jugendlicher. Ich habe gehört, wie er die Freiheit dieser Stadt beschworen hat, in schwierigen Zeiten. Und in den Tagen um den 17. Juni 1953 hing ich, der 13-Jährige, am Radio und hörte gebannt - wenn das Programm nicht gerade gestört wurde -, was auf den Straßen in Berlin passierte. Der Klang der Freiheitsglocke, bis zuletzt ein Markenzeichen im RIAS, hat sich mir tief eingeprägt - wie schön, dass diese Tradition bis heute fortgeführt wird! // Das dritte Elternteil nun, der Deutschlandsender Kultur, war seinerseits ein Kind der friedlichen Revolution und mit der bin ich nun einmal sehr tief verbunden. Er hatte nach dem Mauerfall Teile des ehemaligen Staatsrundfunks der DDR beerbt und dank der Unterstützung des"Runden Tisches" den 3. Oktober 1990 überlebt. In ihm spiegelt sich der Enthusiasmus der neu gewonnenen Freiheit, auch die Lust aufs Experiment. // RIAS und DS Kultur, diese scheinbar grundverschiedenen Programme aus Ost und West, zum Deutschlandradio Berlin zu vereinen, das war wahrlich eine Herausforderung, ja eigentlich ein Wagnis. Aber war es nicht bei genauem Hinsehen genauso mit der Herstellung der Deutschen Einheit? Und so, wie die Deutsche Einheit im Großen gelang, so gelang auch im Deutschlandradio Berlin die "Einheit im Kleinen": mit Euphorie und Aufbruchstimmung, aber auch mit einer gehörigen Portion Veränderungsskepsis und auch mit mancher Enttäuschung. Es gab Besitzstandsdenken und gegenseitiges Misstrauen - hier einstiger "Klassenfeind", dort Mitarbeiter des Staatsrundfunks. Aber genauso gab es auch Hilfsbereitschaft und Offenheit für das Neue. // Dieser Festakt ist ein schöner Anlass, all jenen "Danke" zu sagen, die damals unvoreingenommen aufeinander zugegangen sind. Die erst einmal gefragt haben: Was ist das für ein Mensch? Oder: Wie finden wir zusammen? Danke an all diejenigen, die gesagt haben: Wie spannend diese Zeiten sind, welch ein Glück, sie gemeinsam gestalten zu dürfen! Die nicht dem Alten nachgetrauert haben, oder auch dem verlorenen Zauber des Übergangs. Es war wichtig und es war wertvoll für das Zusammenwachsen, dass hier an dieser Stelle nicht einfach "abgewickelt" wurde, sondern Ost- und Westdeutsche gemeinsam etwas entwickelt haben, journalistische Standpunkte und Formate nämlich. // So wurde am Berliner Standort die neue Hauptstadt publizistisch vorbereitet, bevor noch Parlament und Regierung vom Rhein an die Spree kamen. So spiegelt sich im Deutschlandradio, worüber wir uns freuen und worauf wir mit Stolz blicken dürfen - das Glück der Wiedervereinigung, die unsere Nachbarn in je eigener Weise unterstützten und die dann in das Zusammenwirken unseres Kontinents einmündete. // Nun ist das Kind der Deutschen Einheit längst volljährig. Im Herbst feiern wir den 25. Jahrestag der großen Demonstrationen des Bürgermuts im Osten und den darauf folgenden Mauerfall. Heute sortiert hoffentlich niemand mehr im Deutschlandradio nach "Ossis" und "Wessis". Doch der Programmauftrag seiner Sender bleibt bestehen: die Deutschen, die politisch wie regional so unterschiedlich geprägt sind, miteinander zu verbinden. Und das in einem aufgeklärten nationalen Diskurs, wie in einer Vermittlung der verschiedenen kulturellen Traditionen. // Wir sind froh über Deutschlands eigenständige und selbstbewusste Länder. Bei uns, das wissen wir lange, ist kulturell nirgendwo "Provinz". Gerade deshalb braucht unser Land beides: Programme, die regionale Identitäten wiederspiegeln und stärken. Und Programme, die föderale Vielfalt bündeln und hörbar machen, mit Korrespondenten in Schwerin und Stuttgart, in München und Magdeburg. // Unser Land ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zusammengewachsen, sondern es ist zugleich erwachsener geworden. Es ist nicht mehr so viel mit sich selbst beschäftigt, sondern schaut mehr und mehr nach draußen, nach Europa und in die Welt. Auch darum brauchen wir ein nationales Hörfunkangebot, das über Ereignisse in Algier und Ankara, in Kiew und Kopenhagen informiert und seinerseits Deutschlands Stimme im Ausland prägt. // Wer heute die Vielfalt unserer Hörfunklandschaft, zu der die Programme des Deutschlandradios gehören, mit fremden Ohren zu hören versucht, der kann keinen Zweifel daran haben, wie wertvoll eine öffentlich-rechtliche, aber dennoch staatsferne Säule unseres dualen Rundfunksystems ist. Die Rundfunkfreiheit des Grundgesetzes gewährleistet deshalb eine Medienlandschaft, die an Vielfalt ausgerichtet ist und eine politische Instrumentalisierung des Rundfunks verhindert. Für die heute gefeierten Programme bedeutet diese grundgesetzliche Gewährleistung: Was für ein Privileg, bundesweit und werbefrei senden zu dürfen! Welch ein Privileg, nicht auf Quote schielen zu müssen! Welch ein Privileg, noch in ganzen Sätzen Radio machen zu dürfen! // Wie alle Privilegien sind auch diese unter scharfer Beobachtung all jener, die sie nicht genießen, und auch derjenigen, die dafür bezahlen. Ihre Aufgabe, meine Damen und Herren, besteht darum auch darin, diesen Zustand, in dem Sie sich befinden, kontinuierlich zu begründen. Verlangt sind bisweilen Gratwanderungen: innovativ zu sein und neue Technologien zu nutzen - nicht aber um den Preis der Qualitätsminderung. Themen abseits vom Meinungshauptstrom zu finden - ohne dabei in einer Nische zu versickern. Komplexe Zusammenhänge auch komplex darzustellen - aber nicht zum Umschalten zu verleiten. Und wie wichtig Verantwortungsbewusstsein im Journalismus ist, das sehen wir gerade in Zeiten, in denen manche Medien zu Empörungsverstärkern mutieren, die Urteile fällen, bevor ein Sachverhalt überhaupt geklärt ist. // Die Preise, die Ihre Programme und Ihre Macherinnen und Macher in den letzten Jahren bekommen haben, zeigen: Sie werden Ihrer Verantwortung gerecht. Einen ganz frischen Preisträger haben Sie heute Abend mit der Moderation beauftragt - Kompliment, lieber Herr Scheck! // Es gäbe noch vieles zu sagen. Zu den irrwitzigen Veränderungen, die gerade die Art und Weise der menschlichen Kommunikation revolutionieren. Denken wir mal zurück: Im Jahr des Mauerfalls schrieb ein gewisser Tim Berners-Lee am Kernforschungszentrum CERN ein Papier mit dem lapidaren Titel "Informations-Management - Ein Vorschlag". Heute ist die Welt ohne seine Erfindung, das World Wide Web, kaum noch vorstellbar - und der Globus, den hier, oben auf dem Dach dieses Gebäudes, die Giganten stemmen, bekommt eine ganz neue Bedeutung. // So unmittelbar wie das Radio heute, können auch andere Medien sein. Was bleibt, ist das Bedürfnis nach verlässlicher Information, nach verständlicher Einordnung, nach Orientierung in einer Gegenwart, die viele doch als immer unübersichtlicher empfinden. Und genau dies ist ein ungeheuer wichtiger Auftrag. Denn unsere Demokratie ruht auf der Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, sich in der Unübersichtlichkeit nicht zu verlieren oder zu verirren, sondern sich eine eigene Meinung bilden zu können. // Dem Deutschlandradio, seinen Programmen und allen Verantwortlichen sage ich sowohl als Hörer als auch als Präsident: herzlichen Dank! Sie haben uns in den vergangenen 20 Jahren durch allen Wandel hindurch zuverlässig begleitet. Sie haben mit Verantwortungsbereitschaft Veränderung gewagt. Ich wünsche Ihnen den Mut, sich weiter zu wandeln, wenn es notwendig ist und die Weisheit zu erkennen, wann das notwendig ist. Und damit alles Gute für die kommenden Jahre!
-
Paul Gauguin
Dies war ja Europa - das Europa von dem ich mich befreit zu haben glaubte, nur noch vergröbert durch die Spielarten des kolonialen Snobismus.
-
Heinrich "Heiner" Geißler
Die Politik hat sich den Finanzmärkten ausgeliefert. Wir brauchen neue Formen der Demokratie.