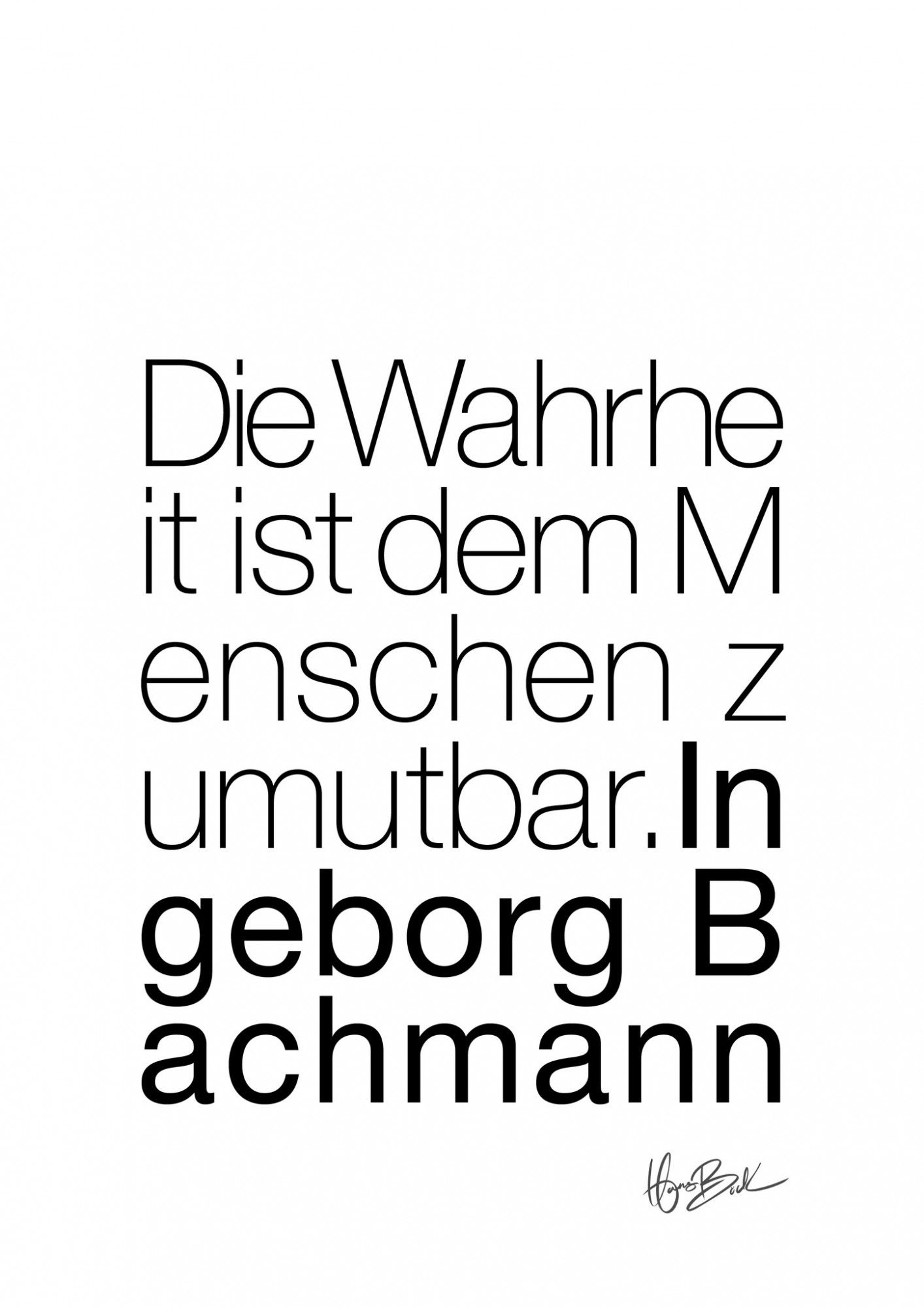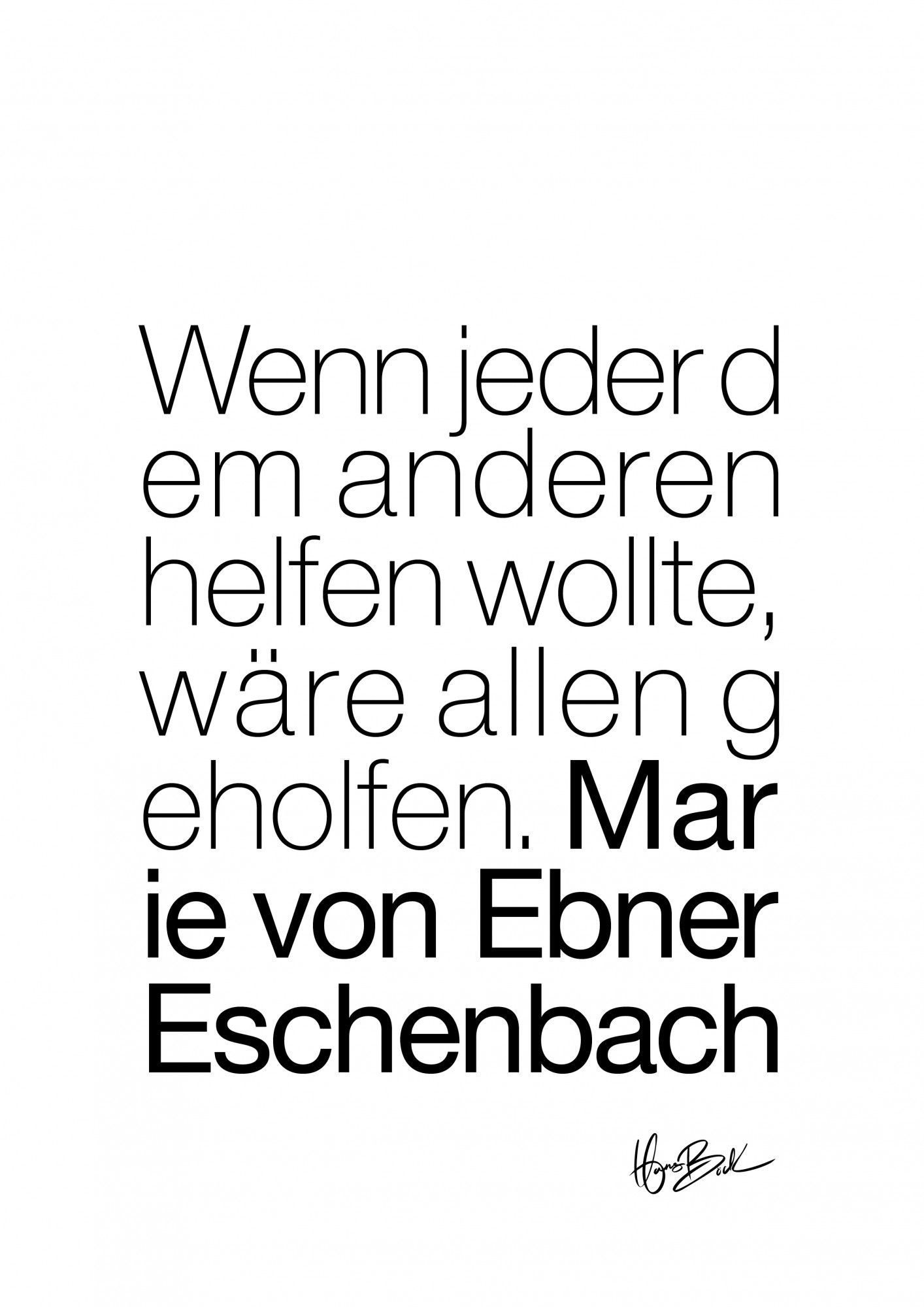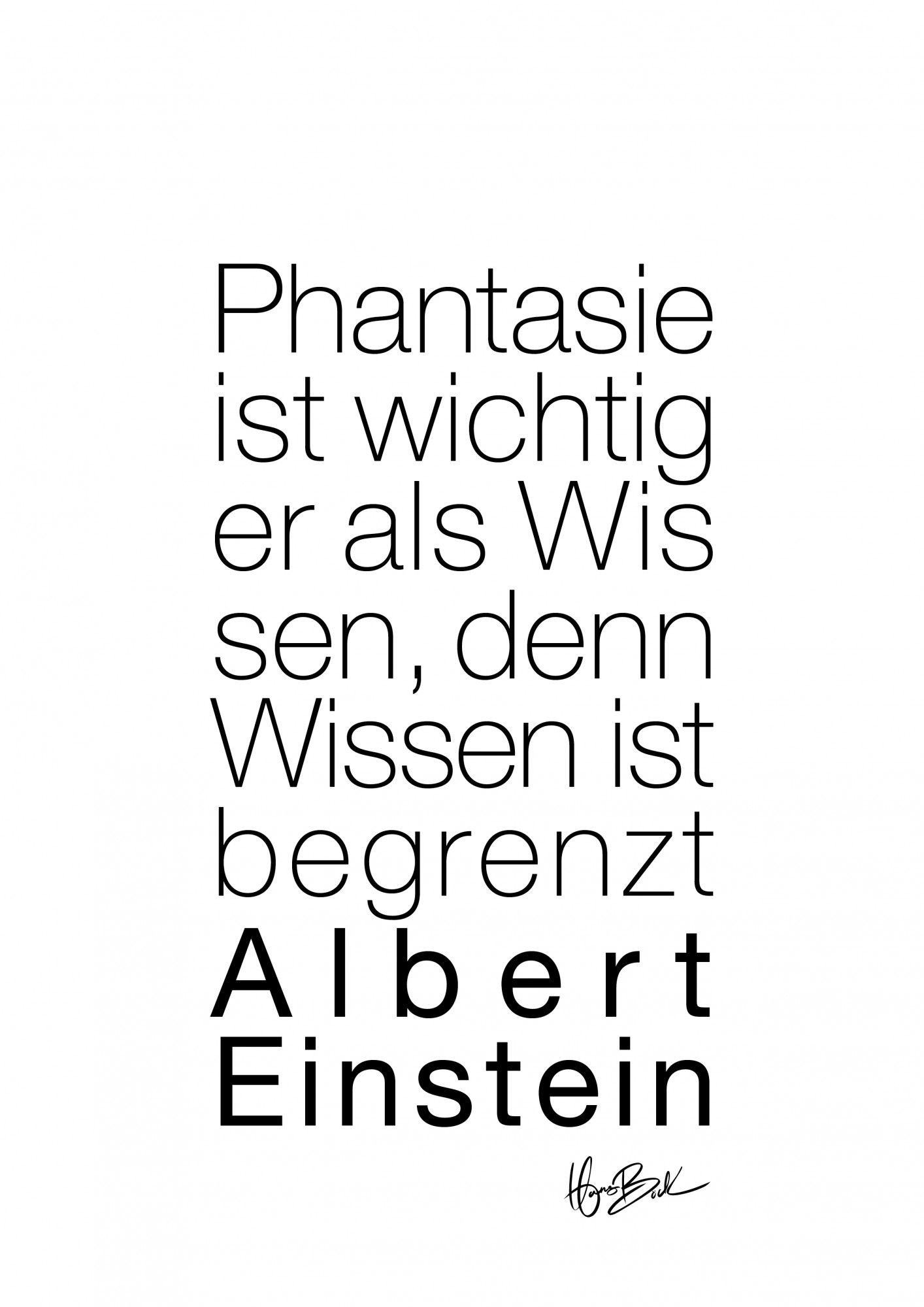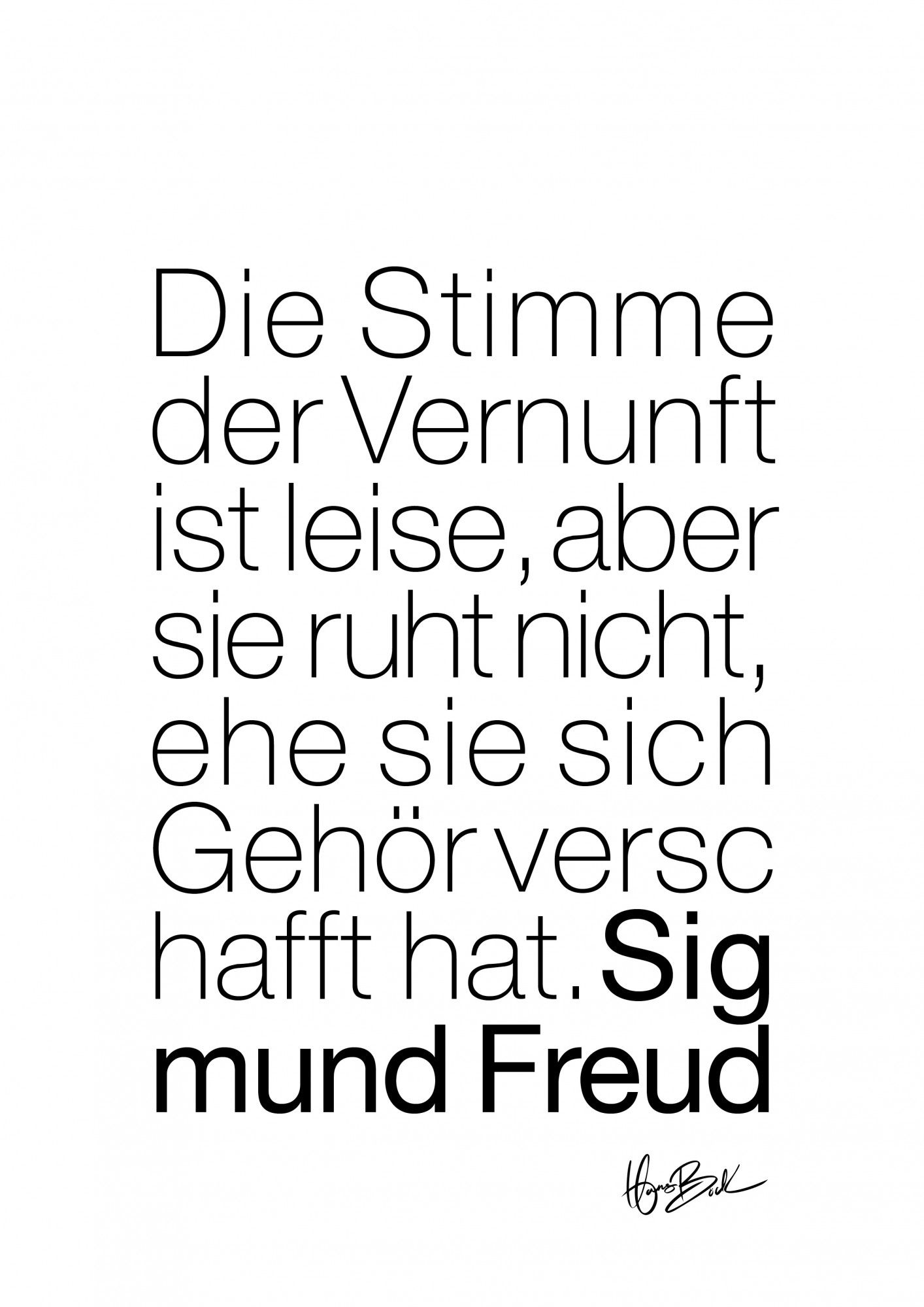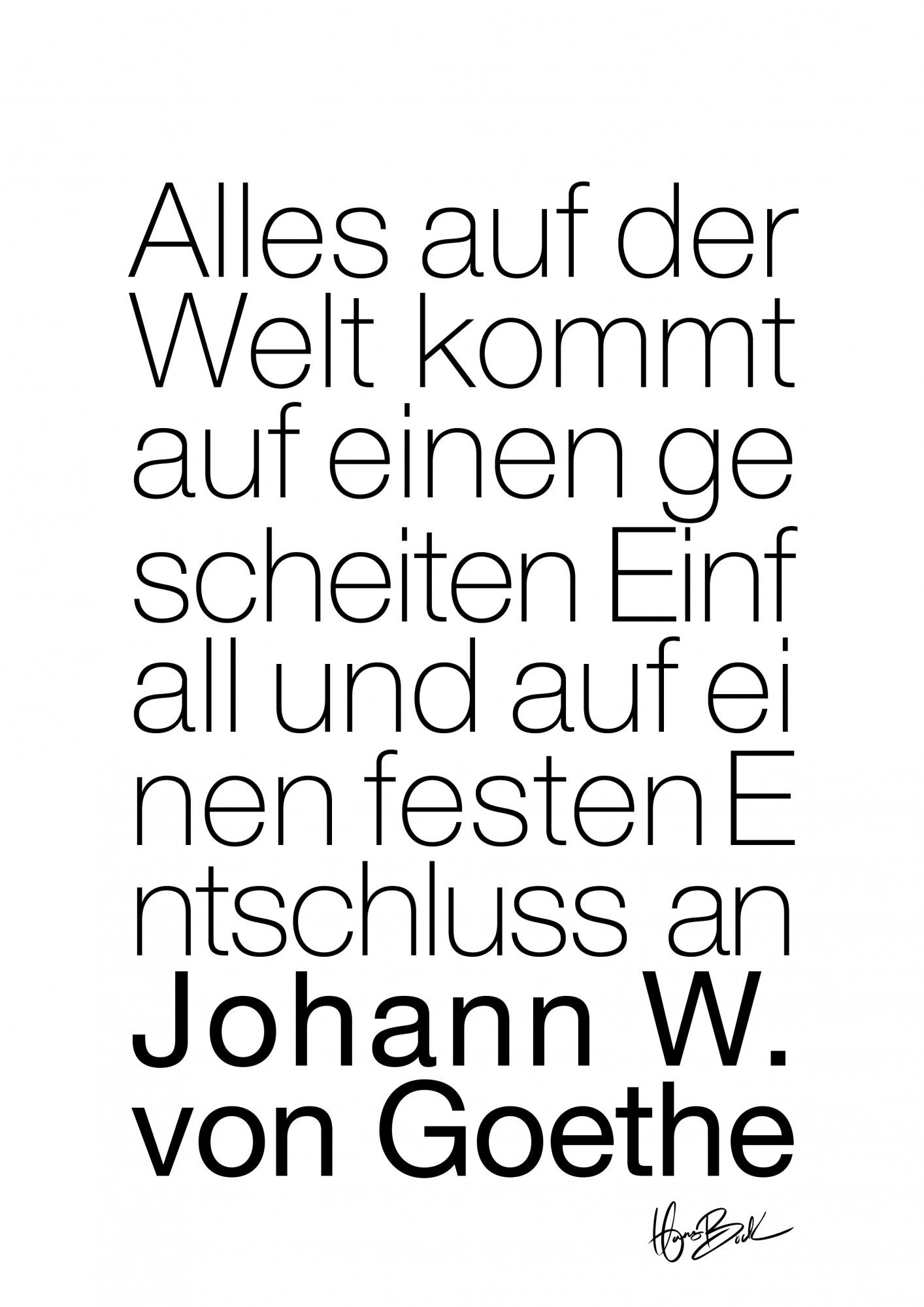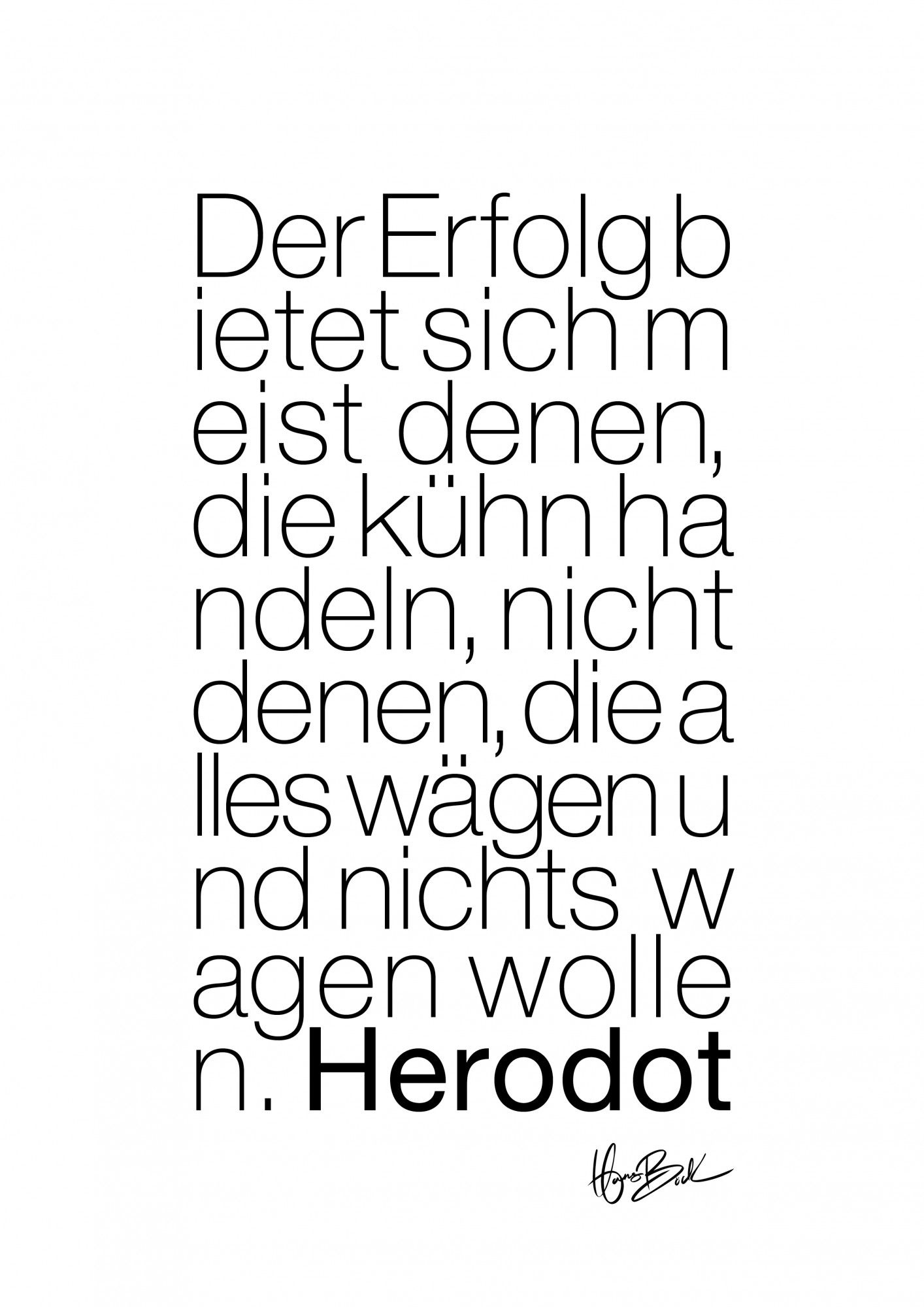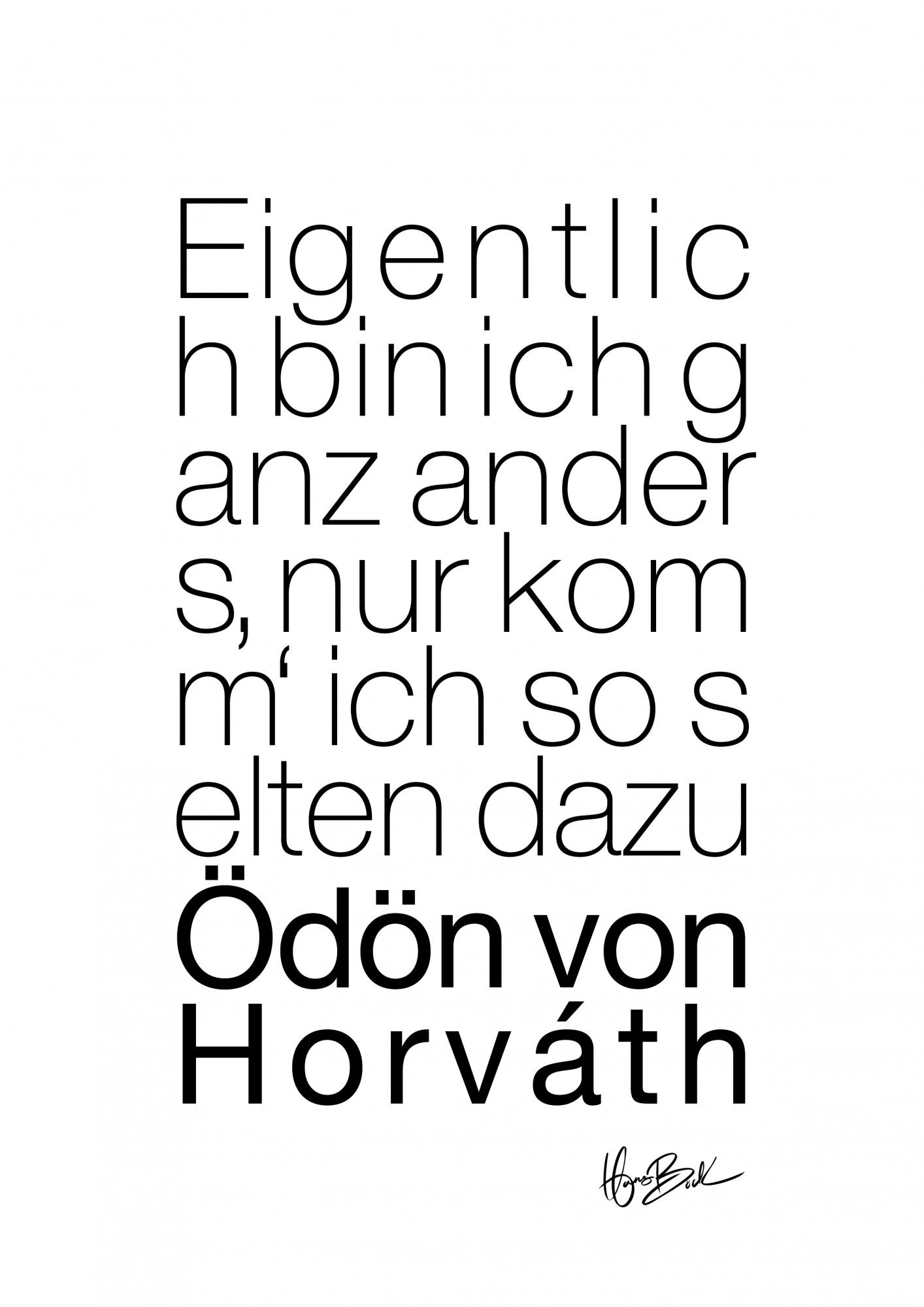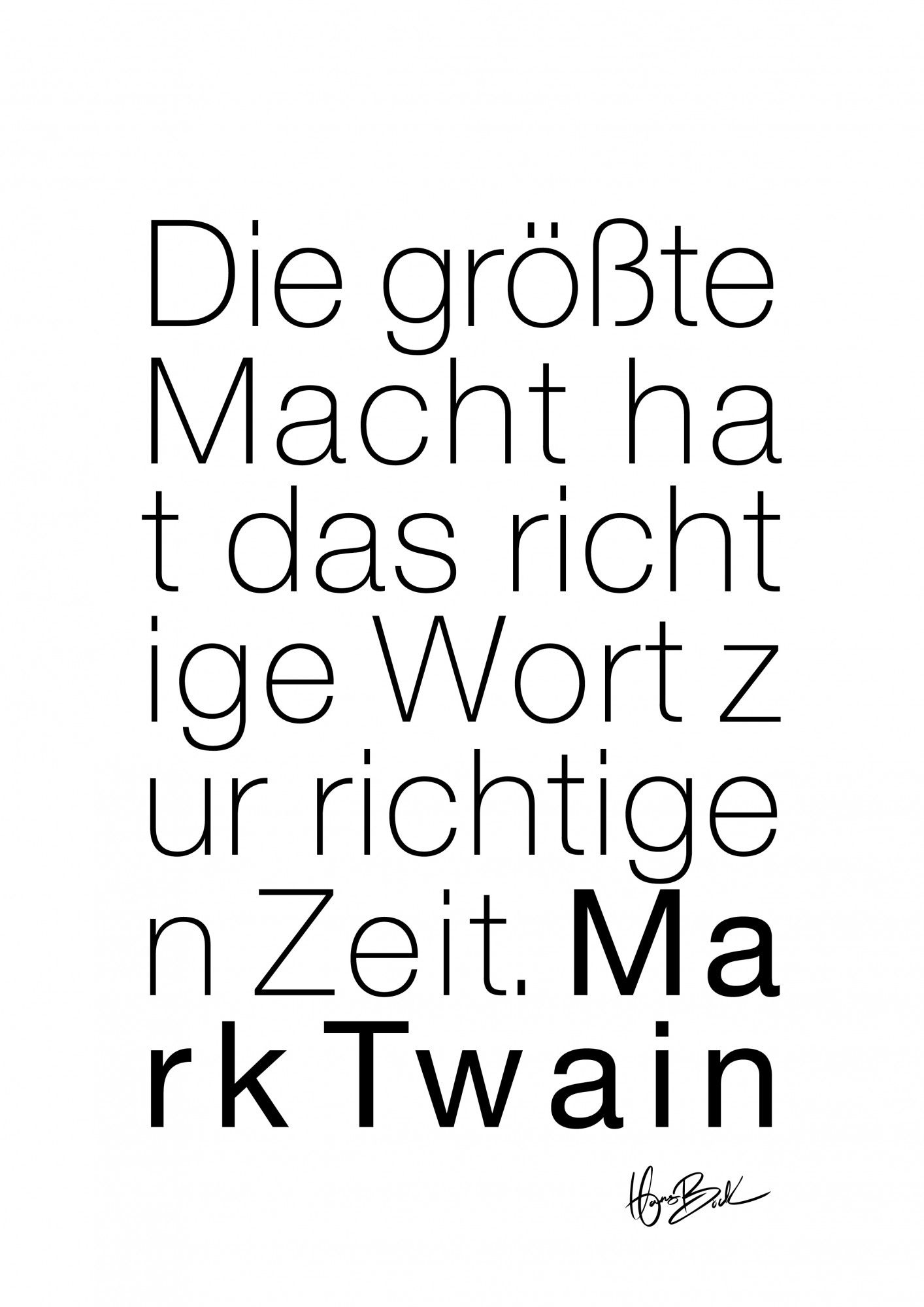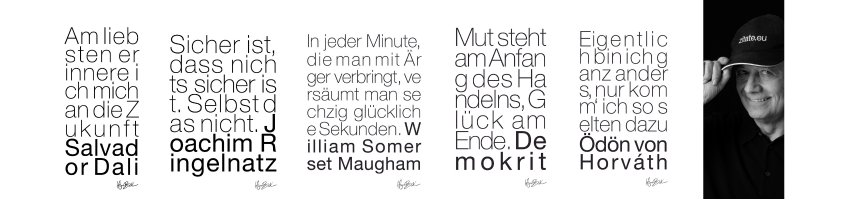Zitate zu "Demokratie"
-
Heinrich "Heiner" Geißler
Die Politik hat sich den Finanzmärkten ausgeliefert. Wir brauchen neue Formen der Demokratie.
-
Hans-Dietrich Genscher
In dieser Nacht wird die Teilung Europas für immer überwunden sein. Nicht das alte oder das neue Europa, sondern das junge Europa beginnt eine neue Zukunft.
-
Hans-Dietrich Genscher
Nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärkung des Rechts schützt die Interessen aller Staaten am besten.
-
Heinz Gernhold
Angenommen, es gäbe wirklich eine Demokratie - was machten wir dann mit den Politikern?
-
Dr. Eva Glawischnig
Es gibt ein unschlagbares Verjüngungsmittel - den Ausstieg aus der Politik.
-
Isaac Goldberg
Diplomatie besteht darin, die hässlichen Dinge auf die netteste Art zu sagen.
-
Isaac Goldberg
Diplomatie ist die Kunst, garstige Dinge auf die netteste Weise zu tun oder zu sagen.
-
Michail Sergejewitsch Gorbatschow
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne Kritik Demokratie geben kann. Damit fängt sie an.
-
Michail Sergejewitsch Gorbatschow
Wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen.
-
Sigmund Graff
Der Vorzug freiheitlicher Regierungsformen besteht darin, daß gerade durch ihr unsympathisches Parteiengezänk immer wieder einmal die Wahrheit ans Licht kommt: im Gegensatz zu dem Dauerdunkel und der Scheinfriedlichkeit autoritärer Systeme. Das einzige, was in diesen klarer als in der Demokratie sein dürfte, ist die Frage der Verantwortlichkeit.
-
Sigmund Graff
Die Diktatur gleicht einer Dampframme, die Demokratie einer Wanderdüne.
-
Sigmund Graff
Die Gefahr der Demokratie sind weniger die Ordnungsstörer als alle, die die Ordnungsliebe übertreiben.
-
Sigmund Graff
Die Verantwortlichen der Diktatur sind hartherzig, die der Demokratie harthörig.
-
Sigmund Graff
Es ist bekannt, daß sich die Millionäre unter der Demokratie wohler fühlen als die Demokratie mit ihren Millionären.
-
Sigmund Graff
In der Diktatur fließt Blut - in der Demokratie Geld: da wie dort lautlos, aber nicht erfolglos.
-
Sigmund Graff
In der Diktatur glaubt man an unfehlbare Meinungen, in der Demokratie an unabhängige.
-
Günter Grass
Jede demokratische Gesellschaft, die ihre Konflikte nicht austrägt, sondern durch Verbotserlasse konserviert hört auf, demokratisch zu sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu begreifen.
-
Mag. Karl-Heinz Grasser
Die politische Kultur in diesem Land ist - und ich war vergangene Woche das erste Mal in dem Theater, das man Parlament nennt - auf allen Seiten verbesserungswürdig.
-
Mag. Karl-Heinz Grasser
Für mich ist es völlig unfassbar, dass sich die Politik im Sommer so einfach in den Urlaub verabschiedet. Das Parlament wird einfach zugesperrt. Solche Privilegien haben sonst alleine die österreichischen Lehrer.
-
Mag. Karl-Heinz Grasser
Streik ist kein geeignetes Mittel in der Demokratie.